Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle auf Rekordtief
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat den Bericht zur "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" (SuGA) für das Berichtsjahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht wird jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt.

Neben statistischen Ergebnissen unter anderem zur Erwerbstätigkeit, zum Arbeitsunfall- und Berufskrankheitengeschehen befasst sich der Schwerpunkt des Berichts mit den "Geschlechterungleichheiten in der Arbeitswelt". Denn nach wie vor zeigen sich deutliche Unterschiede bei Frauen und Männern, beispielsweise bei der Berufswahl, im Umfang der Arbeitszeit und in Verdiensten und Arbeitsbedingungen.
So ist die Erwerbstätigenquote im Berichtsjahr 2023 bei Frauen mit 73,6 Prozent immer noch niedriger als bei den Männern (80,8 Prozent). Große Unterschiede zeigen sich auch bei der Arbeitszeit: Jede zweite Frau (49,9 Prozent) arbeitet in Teilzeit. Bei den Männern macht dies nur in etwa jeder Achte (13,3 Prozent). Insgesamt ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im Vergleich zu 2022 um 0,6 Millionen angestiegen und liegt bei 43,1 Millionen.
Weiter gesunken ist die Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle (838.792 in 2023). Mit 18,8 Arbeitsunfällen je 1.000 Vollzeitäquivalente ist die Unfallquote niedriger als in den Vorjahren. Zudem starben weniger Menschen an den Folgen eines Arbeitsunfalles als in allen erfassten Jahren zuvor (499). Auch die Zahl der tödlichen Wegeunfälle erreichte mit 225 ein Rekordtief. Daneben verzeichneten sowohl die Zahl der Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit (150.368) als auch die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten (74.930) einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, was auf das Abklingen der Pandemie zurückzuführen ist.
Im Jahr 2023 waren Beschäftigte durchschnittlich 21,0 Tage arbeitsunfähig. Daraus ergaben sich für das Jahr insgesamt 886,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage. Wie im Jahr 2022 gab es im Berichtsjahr ausgeprägte Erkältungswellen, weshalb die Krankheiten des Atmungssystems mit 18,4 Prozent nach den Muskel-Skelett-System- und Bindegewebserkrankungen (19,3 Prozent) einen hohen Anteil an den Arbeitsunfähigkeitstagen haben. Psychische und Verhaltensstörungen machen 16,0 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage aus.
Neben dem Schwerpunktthema und den statistischen Erhebungen enthält der SuGA 2023 auch einen Überblick über die Aktivitäten der Arbeitsschutzbehörden und Unfallsversicherungsträger.
Der Bericht "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2023" kann als PDF auf der Internetseite der BAuA unter WWW.BAUA.DE/PUBLIKATIONEN heruntergeladen werden.
(Text: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA))
McDonald's, Burger King und Co. zahlen eindeutig zu wenig
Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat der Systemgastronomie mit Branchengrößen wie McDonald's und Burger King vorgeworfen, sich am Geld der Steuerzahler schadlos zu halten. Es sei skandalös, «wenn eine ganze Branche in höchstem Maße sich quersubventionieren lässt von unseren Steuergeldern», sagte die Gewerkschaftschefin in Hamburg am Rande des Aktionstags «SOS Systemgastronomie».

Zahle die Branche doch oft so niedrige Löhne, dass die Beschäftigten auf staatliche Aufstockungen angewiesen seien. Das sei eine wirtschaftliche Quersubventionierung, «die wir uns nicht mehr leisten können».
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verhandelt bereits seit Mitte Juli vergangenen Jahres mit dem Bundesverband Systemgastronomie (BdS) über höhere Löhne für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten bei McDonald's, Burger King und Co.. Vier Verhandlungsrunden, zuletzt am 2. Dezember 2024, haben bislang kein Ergebnis gebracht. «Wir (...) haben ein Angebot auf dem Tisch liegen, was ein Mehr von zehn Cent pro Stunde in der untersten Entgeltgruppe liefert - und das ist für uns keine Verhandlungsgrundlage», sagte NGG-Chef Guido Zeitler.
Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der mehr als 830 BdS-Mitgliedsunternehmen einen Einstiegslohn von 15 Euro pro Stunde, 500 Euro mehr pro Monat ab der Tarifgruppe 2 und eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro für NGG-Mitglieder. Für die Auszubildenden verlangt die NGG im ersten Lehrjahr 1.150 Euro pro Monat, im zweiten 1.250 Euro und im dritten 1.350 Euro. Außerdem soll es eine Abstandsklausel zum Mindestlohn geben.
Zeitler betonte, die Systemgastronomie habe in der Branche den besten Neustart nach der Corona-Pandemie hingelegt und mache einen Umsatz in Höhe von rund 31 Milliarden Euro. Dennoch gebe es viele Beschäftigte, die trotz Vollzeitjob auf Transferleistungen wie Wohn- oder Bürgergeld angewiesen seien. Das sei ein Geschäftsmodell, das so nicht mehr hinnehmbar sei.
Ob und wann es eine fünfte Verhandlungsrunde gibt, ist derzeit unklar. «Der Arbeitgeberverband hat uns zur Schlichtung aufgefordert», sagte NGG-Verhandlungsführer Mark Baumeister. Doch das komme bei einem Angebot von 13,12 Euro pro Stunde und einer Tariflaufzeit von 3,5 Jahren für die NGG nicht infrage. «Wir haben gesagt, mindestens 13,50 Euro, jetzt, in der eins, ab dem 1. Januar, dann reden wir darüber. Auf diese Antwort warte ich jetzt seit knapp vier Wochen.»
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, zogen in Hamburg nach NGG-Angaben rund 300 Beschäftigte in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Baumeister kündigte auch weitere Warnstreiks an, sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen. Parallel zum Aktionstag legten auch Beschäftigte des Lieferdiensts Lieferando die Arbeit nieder, um ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck zu verleihen, wie Zeitler sagte.
(Text: dpa)
Tarifrunde für 170.000 Post-Beschäftigte beginnt
Für die 170.000 Postboten, Paketzusteller und anderen Beschäftigten der Deutschen Post beginnen die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn und weitere Urlaubstage bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

«Nur mit deutlichen Lohnsteigerungen für die Beschäftigten lassen sich die noch immer hohen Kosten und Lebensmittelpreise bewältigen», sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis laut Mitteilung. Die große Mehrheit der Post-Beschäftigten verdiene immer noch weniger als das Medianeinkommen in Deutschland.
Verdi zufolge arbeiten neun von zehn Post-Beschäftigte zudem unter hoher körperlicher Belastung, etwa durch bis zu 31,5 Kilogramm schwere Pakete und extreme Wetterlagen. Weitere Urlaubstage seien deshalb unerlässlich, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. «Der Krankenstand liegt auf Rekordhöhe», so Kocsis.
Die Deutsche Post teilte mit, die Forderung der Gewerkschaft ignoriere die Sachlage im Unternehmen. Angesichts hoher Investitionsbedarfe und schrumpfender Briefmengen gewähre die Netzagentur nicht den nötigen Spielraum für Preiserhöhungen, hieß es in einer Mitteilung. Zudem habe die Post die Gehälter seit dem letzten Abschluss im Schnitt um 11,5 Prozent erhöht. Dennoch werde die Post konstruktiv in die Verhandlungen gehen.
Zum Jahreswechsel hatte die Deutsche Post das Porto kräftig erhöht. Für einen Standardbrief fallen statt 85 nun 95 Cent an, auch andere Sendungsarten verteuerten sich.
(Text: dpa)
Lufthansa-Konzern will 10.000 Leute einstellen
Der Lufthansa-Konzern will 2025 weltweit rund 10.000 Menschen neu einstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang der Planzahl um etwa 3.000 Köpfe, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Gleichwohl werde die Gesamtzahl der Mitarbeitenden auch nach Abzug der Abgänge steigen, erklärt ein Sprecher.

Aktuell beschäftigt Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern mehr als 100.000 Menschen in 90 Ländern. Gesucht werden Kräfte für die Kabine, für technische Berufe, Verwaltung sowie für Dienstleistungen am Boden. In den Cockpits der Jets gibt es 800 neue Jobs für Piloten und Pilotinnen. Weniger Einstellungen als im Vorjahr soll es bei der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines geben, die gerade ein Sparprogramm durchläuft.
Rund die Hälfte der Jobs ist der Mitteilung zufolge in Deutschland zu besetzen. Lufthansa bleibe ein attraktiver Arbeitgeber, sagt Personalvorstand Michael Niggemann. «Allein im vergangenen Jahr haben uns konzernweit 350.000 Bewerbungen erreicht und wir haben über 13.000 Mitarbeitende eingestellt.»
(Text: dpa)
Krank zur Arbeit?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einer zunehmenden Tendenz bei Beschäftigten in Deutschland, trotz Krankheit zu arbeiten. «"Präsentismus", also krank bei der Arbeit zu erscheinen, ist branchenübergreifend weit verbreitet», sagte Anja Piel von der DGB-Führung am Montag (6. Januar) in Berlin.

Piel reagierte damit auf einen Vorstoß von Allianz-Chef Oliver Bäte. Bäte empfiehlt, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen.
Piel hielt dem entgegen, die Entgeltfortzahlung bei Krankheit sei ein hohes Gut angesichts des Umstands, dass immer mehr Menschen trotz Krankheit arbeiteten. Das DGB-Vorstandsmitglied sagte: «Niemand braucht aktuell Vorschläge, die noch mehr Beschäftigte dazu bringen, krank zu arbeiten.»
Streit um Karenztag: Bäte hatte vorgeschlagen, den Karenztag wieder einzuführen. «Damit würden die Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen», sagte der Vorstandschef dem «Handelsblatt». Die Arbeitgeber würden so entlastet. In der Bundesrepublik gilt - anders als in einigen anderen Ländern - seit Jahrzehnten die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag.
Der Allianz-Chef sieht den hohen Krankenstand in Deutschland als Kostenproblem. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 2023 durchschnittlich 15,1 Arbeitstage krankgemeldet. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit weist für 2023 sogar einen noch höheren Durchschnittswert aus: Demnach hatte weit über die Hälfte der DAK-Versicherten von Januar bis Dezember 2023 mindestens eine Krankschreibung. Im Gesamtjahr waren es laut DAK im Durchschnitt 20 Fehltage pro Kopf.
DGB warnt vor «Präsentismus»!
Piel sagte dagegen, das Bild zu Krankschreibungen zeige keinen Handlungsbedarf. Die Gewerkschafterin führte Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an, die keinen dramatischen Anstieg der Fehlzeiten in Deutschland zeigten, weder im Vergleich mit anderen EU-Staaten, noch im Zeitverlauf.
«Schon vor Corona gaben etwa 70 Prozent der Beschäftigten an, mindestens einmal im Jahr krank zur Arbeit erschienen zu sein und im Durchschnitt fast neun Arbeitstage pro Jahr trotz Erkrankung gearbeitet zu haben», sagte Piel unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage. Präsentismus schade der eigenen Gesundheit und könne auch zur Ansteckung von Kolleginnen und Kollegen oder Unfällen führen - mit hohen Folgekosten.
Die IG Metall bezeichnete es als unverschämt und fatal, den Beschäftigten Krankmacherei zu unterstellen. «Wer Karenztage aus der Mottenkiste holt, greift die soziale Sicherheit an und fördert verschleppte Krankheiten», sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. «Die deutsche Wirtschaft gesundet nicht mit kranken Beschäftigten, sondern im Gegenteil mit besseren Arbeitsbedingungen.»
Unionspolitiker offen für «neue Ideen»: Der Unions-Fraktionsvize Sepp Müller (CDU) zeigt sich offen für die Idee, dass Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn erhalten. «Unsere Sozialsysteme werden immer weiter beansprucht», sagte Müller dem Nachrichtenportal «Politico». «Aus diesem Grund sollten wir uns meiner Meinung nach nicht vor neuen Ideen verschließen und diese diskutieren. Auch wenn das Thema der Karenztage sich nicht in unserem Wahlprogramm findet, könnte dies ein altbewährter Ansatz sein.»
Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), sagte dem Portal hingegen: «Nur die allerwenigsten Menschen melden sich aus Spaß krank.» Sorge forderte einen «Krankenstands-Gipfel», um mit den beteiligten Akteuren über die Lage zu beraten.
(Text: dpa)
Flexiblere Arbeitszeiten für öffentlichen Dienst in Aussicht
Keine drei Wochen mehr bis zum Start des Tarifpokers für Müllwerker, Busfahrerinnen, Erzieherinnen und Krankenpfleger - Warnstreiks sind wahrscheinlich. Aber schon jetzt gibt es eine erste Annäherung.

Die rund zwei Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen können sich voraussichtlich auf flexiblere Möglichkeiten bei ihrer Arbeitszeit einstellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte auf der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln, auch sie strebe Flexibilisierung bei der Arbeitszeit an. «An ein paar Stellen sind wir sehr beieinander», sagte Faeser an die Adresse der Gewerkschaften.
Der dbb und die Gewerkschaft Verdi fordern für die am 24. Januar startenden Tarifverhandlungen unter anderem die Einrichtung eines «Mehr-Zeit-für-mich-Kontos». Beschäftigte sollen am Ende eines bestimmten Zeitraums entscheiden, ob zusätzlich geleistete Arbeitszeit mit Überstundenzuschlägen ausgezahlt oder auf das neue Zeitkonto gebucht wird. An der Seite des Bundesinnenministeriums werden die kommunalen Arbeitgeber mit den Gewerkschaften verhandeln.
Faeser: «Freue mich auf die Tarifgespräche»
«Ich freue mich auf die Tarifgespräche», sagte Faeser. Sie sei zuversichtlich, dass es einen tragfähigen, allen Interessen gerecht werdenden Abschluss geben werde. Vom in Potsdam verhandelten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (TVöD) sind laut dbb mehr als 2,6 Millionen Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen.
Die Kernforderung der Gewerkschaften: eine Entgelterhöhung im Volumen von 8 Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die Beamtinnen und Beamten des Bundes drängt der dbb auf Änderungen der Besoldung und eine Rückführung der Wochenarbeitszeit von 41 auf 39 Stunden.
Gewerkschaften fordern Arbeitszeitsouveränität:
Der dbb-Vizechef Volker Geyer sagte: «In jeder Einkommensrunde liegt eine Chance, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen.» Geyer weiter: «Bei der Arbeitszeitsouveränität hinken wir der Wirtschaft meilenweit hinterher.» An Faeser gewandt forderte der dbb-Vertreter: «Machen Sie uns nicht erst wieder in der dritten Runde ein Angebot, das wird der Lage nicht gerecht.»
Von der Einkommensrunde für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes betroffen sind Nahverkehr, Müllabfuhr, Rathäuser und zahlreiche andere Bereiche. Begleitet werden dürfte die Tarifrunde von Warnstreiks in den Kommunen. Verdi-Chef Frank Werneke hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt: «Es gibt Frust. Auch darüber, dass sich nicht wirklich was nach vorne entwickelt.» Auf die Frage, ob Warnstreiks wahrscheinlich seien, sagte Werneke: «Es ist nicht auszuschließen.» Die Stimmung sei aufgeheizt.
«Beschäftigte sind am Limit»!
«Die Beschäftigten des öffentlichen Diensts sind am Limit», sagte Geyer. Sie hätten immer mehr Aufgaben zu schultern und immer mehr Gesetze und Verordnungen auszuführen. «Hier noch eine Berichtspflicht, da noch eine Sonderaufgabe – so funktioniert das nicht», sagte Geyer, der in Köln den erkrankten dbb-Chef Ulrich Silberbach vertrat.
Geyer und Faeser betonten, ein starker Staat sei essenziell für eine funktionierende Demokratie. Eindringlich forderte der Gewerkschafter mehr Investitionen des Staates in die öffentliche Infrastruktur, in Bildung, Sicherheit, Gebäude, Digitalisierung. Die Politikerin erklärte im Einklang mit dem SPD-Programm zur Bundestagswahl und unter Applaus des Publikums ihre Bereitschaft zur Änderung der Schuldenbremsen-Regel im Grundgesetz, um solche Investitionen möglich zu machen - und zwar in Zeiten eines aktuell andauernden Kriegs in Europa, wie Faeser mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine sagte.
67 Prozent für mehr staatliche Fürsorge:
Laut einer neuen, vom dbb in Auftrag gegebenen Umfrage halten 67 Prozent der Bevölkerung Investitionen in den Ausbau der staatlichen Daseinsfürsorge, wie etwa in Bildung, Sicherheit und Infrastruktur, für sehr wichtig. 20 Prozent der Befragten halten demnach die Beibehaltung der Schuldenbremse und den Abbau von Altschulden oder allgemeine Steuersenkungen für sehr wichtig. Erhoben hat die repräsentativen Zahlen das Meinungsforschungsinstitut forsa.
(Text: dpa)
Acht-Prozent-Forderung «völlig berechtigt»
Rund drei Wochen vor Beginn der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verteidigt der Deutsche Beamtenbund (dbb) die hohen Tarifforderungen der Gewerkschaften von acht Prozent.

Der stellvertretende ddb-Bundesvorsitzende Volker Geyer sagte der «Rheinischen Post»: «Die Forderung ist völlig berechtigt. Uns fehlen im öffentlichen Dienst die Beschäftigten. Heute sind schon 570.000 Stellen unbesetzt, in den kommenden zehn Jahren scheiden noch einmal 1,4 Millionen aus. Deshalb müssen wir jetzt die Chance nutzen, den Arbeitgeber Staat attraktiver zu machen.»
Am 24. Januar starten die Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund verlangen acht Prozent mehr Einkommen für die Beschäftigten - mindestens aber 350 Euro pro Monat. Hinzu kommt die Forderung nach zusätzlichen drei freien Tagen. Geyer warnte die Arbeitgeber davor, die Mobilisierungsfähigkeit der Beschäftigten zu unterschätzen. «Streiks würden die Bürger recht schnell spüren», sagte er.
Der dbb-Vize räumte ein, dass einige Städte und Gemeinden finanzielle Probleme haben. Er betonte aber auch: «Die Beschäftigten werden die Finanzprobleme der Kommunen in einer Tarifrunde nicht lösen können.» Die Kommunalfinanzen müssten «dringend neu ausgehandelt» werden.
(Text: dpa)
Erwerbstätigenzahl auf Rekord
Trotz der Wirtschaftskrise hat die Zahl der Beschäftigten in Deutschland 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Im Jahresdurchschnitt waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort hierzulande erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

«Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990.» Jedoch wuchs die Beschäftigung nur noch in Dienstleistungsbereichen, während sie im Bau und im Produzierenden Gewerbe sank. Im neuen Jahr erwarten Fachleute mehr Arbeitslose.
Nach einer ersten Schätzung der Wiesbadener Statistiker kletterte die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresschnitt 2024 um 72.000 Menschen oder 0,2 Prozent zum Vorjahr. Grund war die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Das überwiege die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels, erläuterte die Behörde.
Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006 stetig. Allerdings verliere der Anstieg seit Mitte 2022 deutlich an Dynamik. Entscheidend für das Plus im vergangenen Jahr war die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahresschnitt um 146.000 auf 42,3 Millionen wuchs, während es erneut weniger Selbstständige gab.
Wirtschaftskrise hinterlässt bereits Spuren: Allerdings macht sich die Wirtschaftskrise schon bemerkbar. So stieg die Beschäftigung 2024 nur in Dienstleistungsbereichen, wo gut drei Viertel der Erwerbstätigen arbeiten. Dort wuchs die Zahl der Beschäftigten zum Vorjahr um 153.000 auf 34,8 Millionen Menschen - unter anderem im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie in Banken und Versicherungen.
In der Industrie und dem Baugewerbe sank die Beschäftigung dagegen. Im Produzierenden Gewerbe (ohne Bau) fiel die Erwerbstätigenzahl 2024 um 50.000 auf 8,1 Millionen Menschen. Auch die Krise im Neubau führte zu Jobverlusten. «Im Baugewerbe ging mit einem Rückgang um 28 000 Erwerbstätige (-1,1 %) auf 2,6 Millionen der seit dem Jahr 2009 andauernde und nur im Jahr 2015 unterbrochene Aufwärtstrend zu Ende», so die Statistiker.
Im neuen Jahr dürfte der Gegenwind zunehmen. Denn die Konjunktur bleibt schwach: 2025 erwartet die Bundesbank nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent, nachdem die deutsche Wirtschaft 2024 das zweite Jahr in Folge leicht geschrumpft sein dürfte.
Die Arbeitsagenturen rechnen mit einer wachsenden Arbeitslosigkeit. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fiel im Dezember zum vierten Mal in Folge auf den niedrigsten Stand seit der Corona-Pandemie. «Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Arbeitslosigkeit auch zu Beginn des neuen Jahres weiter steigen wird», sagte IAB-Forscher Enzo Weber kürzlich.
Nur wenige Branchen erwarten Stellenaufbau!
Auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 49 Branchenverbänden zeigt wenig Optimismus. 20 der 49 Wirtschaftsverbände erwarten demnach 2025 einen Rückgang der Produktion in ihrem Bereich; 13 rechnen mit gleichbleibenden Werten, 16 mit mehr Produktion.
Zudem erwarten 25 Verbände in ihren Branchen 2025 einen Stellenabbau, nur 7 Verbände rechnen mit mehr Beschäftigten. Dazu zählen die Pharmaindustrie sowie der Luft- und Raumfahrzeugbau und Dienstleister wie Speditionen. Weniger Jobs dürfte es etwa in der Eisen- und Stahlindustrie geben, im Maschinenbau, in der Autoindustrie oder am Bau.
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, rechnet ebenfalls mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit - sieht aber auch Chancen in der Verlagerung von Beschäftigung. «Es werden manche Unternehmen Beschäftigung abbauen. In der Industrie vor allem, auch in der Baubranche. Aber diese Menschen werden anderswo unterkommen und gut unterkommen können», sagte Fratzscher dem Deutschlandfunk. Für die Volkswirtschaft sei es wichtig, dass die Beschäftigung dahingeht, wo die Beschäftigten benötigt werden.
(Text: dpa)
Im Tarifjahr 2025 geht es eher um sichere Arbeitsplätze
Der Konflikt um die Zukunft der deutschen VW-Werke zeigt eines überdeutlich: In der deutschen Autoindustrie und auch in anderen Branchen wird die Luft dünner. Die Gewerkschaften sind zu Zugeständnissen bereit, um Arbeitsplätze zu erhalten.

Keine Rede ist mehr von Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich oder von der 32-Stunden-Woche als Regelfall, wenn gleichzeitig Fabriken geschlossen werden sollen.
Laut einer Umfrage im Auftrag des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) planen vier von zehn Firmen im Jahr 2025, Stellen zu streichen. Besonders hart geht es in der deutschen Vorzeigebranche Auto zu, die mit 770.000 Beschäftigten mitten in einem grundlegenden Umbau zur Elektromobilität steckt. Ford, VW oder die großen Zulieferer Continental, Schaeffler, Bosch: Sie alle wollen jeweils Tausende Stellen in ihren deutschen Werken streichen.
Hamburger Abschluss als Wendepunkt: Die Gewerkschaften haben bereits angefangen, kleinere Tarif-Brötchen zu backen. Laut Analyse der Bundesbank stellt der Metall- und Elektroabschluss von Hamburg einen Wendepunkt dar. Im November hatten IG Metall und Arbeitgeber nach nur mäßigen Warnstreiks vereinbart, dass die Gehälter von fast vier Millionen Beschäftigten innerhalb von 25 Monaten in zwei Stufen um 5,1 Prozent steigen - gemessen an der Ausgangsforderung von 7 Prozent in zwölf Monaten durchaus moderat. Der Vertrag gilt in den Kern-Branchen der deutschen Industrie wie Auto, Elektro, Maschinenbau oder Metallerzeugung.
Laut Bundesbank wird es so weitergehen: «Die niedrigeren Inflationsraten, die trübe Konjunktur und eine geschwächte Arbeitsnachfrage lassen auch allgemein in den kommenden Monaten im Vergleich zu den Vorjahren moderatere Abschlüsse erwarten», schreibt sie in ihrer Deutschland-Prognose. Die Tarifverdienste dürften 2025 durchschnittlich nur noch um 2,5 Prozent wachsen und damit die Inflation knapp ausgleichen.
Einmalzahlungen kommen nicht wieder!
Hohe Reallohnsteigerungen wie noch 2024 sind im neuen Jahr schon aus technischen Gründen kaum drin. Zum Jahresende läuft die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit aus, die sogenannten «Inflationsausgleichsprämien» steuer- und abgabenfrei zu stellen. In nahezu allen Tarifabschlüssen ist von dem Hebel Gebrauch gemacht worden, um kurzfristig die Kaufkraftverluste der Beschäftigten mit hohen Nettozahlungen zu begrenzen.
Die Reallöhne stiegen entsprechend, können das nun aber nicht wiederholen. Thorsten Schulten, Tarifexperte beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, hat die Einmalzahlungen daher schon vorab als «zweischneidiges Schwert» bezeichnet. «Schon jetzt ist absehbar, dass sich der Wegfall der Inflationsausgleichsprämien im Jahr 2025 stark dämpfend auf die Tariflohnentwicklung auswirken wird.»
Kleinere Branchen im Fokus: Nach Zählung des WSI-Tarifarchivs werden 2025 die Tarifbedingungen für rund 7,5 Millionen Beschäftigte verhandelt - nach mehr als 12 Millionen im Jahr 2024 also eine eher überschaubare Zahl.
Bei der Mehrzahl der auslaufenden Tarifverträge handelt es sich um eher kleinere Branchen mit weniger als 50.000 Beschäftigten. Die große Ausnahme bildet gleich zu Jahresbeginn der Öffentliche Dienst von Bund und Gemeinden mit knapp drei Millionen Menschen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 8,0 Prozent mehr Gehalt bei einer Mindesterhöhung um 350 Euro. Zusätzlich soll es drei freie Tage geben. Die Verhandlungen beginnen am 24. Januar in Potsdam und sind bis in den März vorausgeplant.
Empfindliche Warnstreiks möglich!
Hier sind empfindliche Warnstreiks etwa in Kitas oder bei der Müllabfuhr ebenso wenig ausgeschlossen wie bei den früheren Staatsbetrieben Bahn und Post, wo Verdi und EVG die Arbeitsbedingungen neu aushandeln. Die Konkurrenz von der Lokführergewerkschaft GDL verhandelt erst im Jahr 2026 wieder - dann erstmals ohne den nun aus Altersgründen ausgeschiedenen Vorsitzenden Claus Weselsky.
Zum Jahresende sind dann die 1,1 Millionen öffentlich Bediensteten der Länder der große Brocken. Zu den weiteren größeren Tarifbranchen, die 2025 verhandeln, gehören das Gebäudereinigungshandwerk, das Kfz-Gewerbe, die Zeitarbeit und das Versicherungsgewerbe.
(Text: Christian Ebner, dpa)
Krankenstand steigt auf Rekordhoch
Deutschlands größte Krankenkasse verzeichnet einen rekordhohen Krankenstand bei ihren versicherten Erwerbstätigen. Von Januar bis November waren diese im Schnitt 17,7 Tage krankgeschrieben, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) in Hamburg mit.
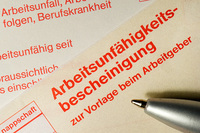
Das sei ein neuer Höchststand, hieß es. In den Vorjahreszeiträumen 2023 sowie 2022 lag der Krankenstand mit 17,4 Fehltagen etwas niedriger, 2021 waren es erst 13,2 Fehltage.
Auch liege der Krankenstand deutlich höher als vor der Coronapandemie 2019, als die TK im Schnitt 14,1 Fehltage in den ersten elf Monaten verzeichnet hatte. Datengrundlage sind die rund 5,7 Millionen bei der TK versicherten Erwerbstätigen.
«Hauptdiagnose für die Fehltage sind nach wie vor Erkältungskrankheiten wie zum Beispiel Grippe, Bronchitis und auch Coronainfektionen», sagte TK-Vorstandschef Jens Baas. «An zweiter Stelle stehen psychische Diagnosen wie Depressionen oder Angststörungen, an dritter Stelle Krankschreibungen aufgrund von Muskelskeletterkrankungen.»
Menschen halten Corona-Vorsicht bei:
Eine Forsa-Befragung im Auftrag der TK zeigt zudem, dass viele Menschen in Deutschland darauf achten, ihre Mitmenschen nicht anzustecken. Bereits bei ersten Anzeichen einer Erkältung gaben demnach 77 Prozent der Befragten an, soziale Kontakte möglichst zu meiden. «Besonders in Pandemiezeiten war die Frage, wie man andere Menschen vor Ansteckung schützen kann, sehr präsent. Dieses Bewusstsein haben offenbar viele Menschen beibehalten», sagte Baas.
Ärger in der Wirtschaft!
Der hohe Krankenstand in Deutschland wirft immer wieder Diskussionen auf. Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius etwa sieht die hohe Zahl der Krankentage deutscher Arbeitnehmer als Problem für den Wirtschaftsstandort.
Mit Blick auf Mercedes-Benz sagte Källenius, wenn unter gleichen Produktionsbedingungen der Krankenstand in Deutschland teils doppelt so hoch sei wie im europäischen Ausland, habe das wirtschaftliche Folgen. Auch Tesla-Chef Elon Musk war ein hoher Krankenstand im Autowerk Grünheide während der Sommermonate bereits ein Dorn im Auge.
(Text: dpa)