Tarifschlichtung für Systemgastronomie vereinbart
Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft NGG und dem Branchenverband laufen seit Juli 2024 - bislang ohne Erfolg. Nun einigten sich die Parteien auf ein Schlichtungsverfahren.

Im Tarifkonflikt für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten der Systemgastronomie wird nun mit einer Schlichtung eine Lösung angestrebt. Darauf einigten sich die Tarifparteien, wie aus Mitteilungen hervorgeht. Die Verhandlungen betreffen unter anderem Schnellrestaurantketten wie McDonald’s, Burger King und Nordsee.
Bei den Tarifparteien handelt es sich um die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und den Bundesverband der Systemgastronomie (BdS). Den Vorsitz der Schlichtung wird laut Ankündigung der Präsident des Landesarbeitsgerichts München, Harald Wanhöfer, übernehmen. Die Schlichtung soll am 11. März beginnen.
Der BdS teilte mit, es gebe nach wie vor erheblichen Differenzen. Das freiwillige Schlichtungsverfahren nannte der Verband einen entscheidenden Schritt.
Die Tarifparteien verhandeln seit Mitte Juli des vergangenen Jahres über eine neue Vereinbarung. Zuletzt hatte die fünfte Verhandlungsrunde am 30. und 31. Januar in Köln zu keinem Ergebnis geführt.
Die Gewerkschaft fordert unter anderem einen Einstiegslohn von 15 Euro pro Stunde und 500 Euro mehr im Monat für die mindestens angelernten Beschäftigten ab der sogenannten Tarifgruppe zwei. NGG-Mitgliedern sollen einmalig 500 Euro gezahlt werden. Der BdS äußert sich auf Nachfrage nicht dazu, was er in den Verhandlungen bietet.
(Text: dpa)
OpenAI eröffnet erstes Deutschland-Büro in München
OpenAI wird sein erstes deutsches Büro in München eröffnen. Das teilte das Unternehmen hinter ChatGPT in San Francisco mit. Deutschland gehört laut dem KI-Start-up beim Thema KI-Nutzung zu den weltweit führenden Ländern.
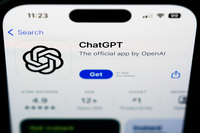
In der bayerischen Landeshauptstadt sitzen bereits die Deutschlandzentralen von US-Tech-Konzernen wie Apple, Microsoft und Intel. Außerdem ist München ein global bedeutender Entwicklungsstandort.
Deutschland gehört für OpenAI zu den wichtigen Märkten. Die Bundesrepublik hat nach Angaben des Unternehmens die höchste Zahl an Nutzern von ChatGPT in Europa und gehört weltweit zu den fünf führenden Ländern in der Nutzung des Chatbots. Die Zahl der Nutzer in Deutschland habe sich alleine im vergangenen Jahr verdreifacht.
Auch bei der Zahl der Anwender, die ein bezahlpflichtiges Abo abgeschlossen haben, liegt Deutschland in Europa auf Platz eins und gehört weltweit zu den drei führenden Ländern. Bei den zahlenden Firmenkunden befinde sich die Bundesrepublik unter den drei führenden Ländern außerhalb der USA. OpenAI hat nach eigenen Angaben weltweit über 300 Millionen wöchentlich aktive Nutzer und mehr als eine Million zahlende Geschäftskunden.
Die genaue Adresse des Münchener Büros steht noch nicht fest. OpenAI werde aber bald Fachkräfte in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung und Kommunikation einstellen sowie Lobbyisten-Positionen besetzen. Mit der Präsenz in Deutschland plane das Unternehmen außerdem, seine Zusammenarbeit mit deutschen Universitäten zu vertiefen.
Konzernchef und OpenAI-Mitbegründer Sam Altman sagte, Deutschland sei für technisches Know-how und industrielle Innovation bekannt. Da überrasche es nicht, dass das Land auch weltweit führend in der KI-Nutzung sei. «Mit der Eröffnung unseres ersten Büros in Deutschland können wir noch mehr Menschen, Unternehmen und Institutionen dabei unterstützen, von dieser transformativen Technologie zu profitieren.»
(Text: dpa)
Arbeitgeberpräsident für mehr 40-Stunden-Wochen
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger plädiert für eine längere Wochenarbeitszeit. «Es wäre gut, wenn wir uns wieder bei mehr Beschäftigten in Richtung 40 Stunden bewegen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Durchschnitt 34,3 Stunden.

«Wenn wir uns darüber freuen, dass wir im Moment 46 Millionen Erwerbstätige haben, dann müssen wir auch darüber reden, dass diese 46 Millionen nicht wesentlich mehr arbeiten als die Deutschen vor etwa 20 Jahren», merkte Dulger an. Damals habe es weniger Beschäftigte und Einwohner gegeben.
Dulger: Deutschland braucht mehr Effizienz!
«Der Erfolg einer Volkswirtschaft misst sich immer noch an ihrem Output. Und wenn es uns mit mehr Beschäftigten gelungen ist, genauso viel fertig zu kriegen wie vor 20 Jahren, dann haben wir nicht viel gekonnt», sagte Dulger. Deutschland brauche eine Steigerung der Effizienz. «Deutschland braucht auch mehr Ganztagsschulen und Kitas – dann können die gut ausgebildeten Menschen mit jungen Kindern, die gern mehr arbeiten wollen, auch wieder mehr arbeiten.»
Es müsse Anreize für Mehrarbeit geben. «Arbeit muss sich wieder lohnen, und es muss auch wieder mehr Netto vom Brutto geben.»
(Text: dpa)
Lohn-Tarifverhandlungen für Maler und Lackierer abgebrochen
Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hat die Tarifverhandlungen für die Maler und Lackierer in der dritten Runde abgebrochen. Als Grund nannte die IG BAU die Weigerung der Arbeitgeber, ein akzeptables Angebot vorzulegen.

"Sie haben sich in einem zähen Ringen nur in Cent-Schritten bewegt. Die Arbeitgeber waren dabei nicht einmal bereit, die Inflation auszugleichen. Zuletzt haben sie zwei Prozent angeboten – und damit für einen Malergesellen gerade einmal 37 Cent pro Stunde mehr. Das ist Lohn-Diät pur. Die Arbeitgeber nehmen damit bewusst in Kauf, dass es den Malern und Lackierern finanziell schlechter geht. Mit Respekt für deren Arbeit hat das nichts zu tun", erklärte IG BAU-Verhandlungsführer Carsten Burckhardt am 31. Januar in Frankfurt.
Die Bau-Gewerkschaft hatte ein Lohn-Plus von acht Prozent gefordert – und damit 1,50 Euro mehr pro Stunde. "Nach dem irrationalen Verhalten der Maler-Arbeitgeber steuert die IG BAU jetzt auf den nächsten Schritt zu: die Schlichtung", so Burckhardt. Insgesamt arbeiten bundesweit rund 115.000 Maler und Lackierer in 21.700 Betrieben.
Die IG BAU übte nach dem Scheitern der Verhandlungen heftige Kritik am Bundesinnungsverband der Maler und Lackierer: "Wer bei nach wie vor guter Auftragslage und Fachkräftemangel händeringend die wirtschaftliche Situation der eigenen Branche kleinzureden versucht und dabei weltpolitische Krisen-Schlagworte ins Feld führt, den kann kein Mensch mehr ernst nehmen. Die Verhandlungsführer der Bundesinnung waren sich nicht zu schade, einen wilden Mix aus Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, wirtschaftlichem Druck aus China und Trump-Politik in den USA als skurrile Gründe aufzufahren. Und das alles nur, um ihr Verhalten als Lohnbremse für die Maler und Lackierer zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, zwischen Aachen und Görlitz zu rechtfertigen. Es bleibt das Geheimnis der Arbeitgeber, was Trump jetzt auch mit den realen Lohnkürzungen der Menschen zu tun hat, die bei uns Fassaden streichen, Wohnungen renovieren oder Kühlerhauben lackieren", so Carsten Burckhardt, der im Bundesvorstand der IG BAU für das Maler- und Lackiererhandwerk zuständig ist.
Andere Branchen – wie etwa das Baugewerbe, das Dachdeckerhandwerk und die Gebäudereinigung – hätten vorgemacht, wie Kompromisse am Tariftisch zu finden seien und wie soziale Verantwortung aussehe. "Wer so schamlos die eigenen Beschäftigten von der Lohnentwicklung abkoppeln will, braucht sich über Fachkräftemangel und fehlenden Nachwuchs bei den Malern und Lackierern nicht zu wundern", so Burckhardt.
(Text: IG BAU)
Verhandlungsauftakt Helios-Kliniken: Arbeitgeber lassen Chance liegen
Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 21.000 Beschäftigten der 33 Helios-Kliniken, für die der Konzerntarif gilt, ist am Freitag (31. Januar 2025) ohne Ergebnis vertagt worden. „Der Arbeitgeber hat den heutigen Verhandlungsauftakt leider nicht genutzt, um ein Angebot auf den Tisch zu legen.

Dabei erwarten die Beschäftigten der Helios-Kliniken, dass ihr Arbeitgeber nicht auf Zeit spielt und ernsthaft über die Forderungen der Beschäftigten verhandelt“, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und Verhandlungsführerin. ver.di erwarte nun zur zweiten Verhandlungsrunde ein erstes verhandlungsfähiges Angebot.
ver.di fordert für die Beschäftigten, die unter den Helios-Konzerntarif fallen, Lohnerhöhungen von acht Prozent, mindestens 350 Euro mehr. Zudem soll es für Auszubildende ein Plus von monatlich 150 Euro geben. Die Arbeit zu besonders ungünstigen Zeiten, also etwa Nachtschichten und Dienste an Feiertagen, soll ebenfalls deutlich besser vergütet werden. Eine weitere ver.di-Forderung ist eine einheitliche Jahressonderzahlung als 13. Monatsgehalt.
„Nachdem die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, erwarten die Beschäftigten dafür einen fairen tariflichen Ausgleich“, begründete Bühler. Die Laufzeit des Tarifvertrages solle zwölf Monate betragen. „Für unsere Mitglieder fordern wir einen besonderen Vorteil von drei zusätzlichen, bezahlten, freien Tagen. Denn nur, wenn sich Beschäftigte gewerkschaftlich organisieren, gibt es gute Tarifverträge“, so Bühler.
Der zweite Verhandlungstermin ist für den 21. Februar 2025 vereinbart.
(Text: dpa)
Jeder vierte Maschinenbauer plant Personalabbau
Die schwache Auftragslage macht vielen Maschinenbauern in Deutschland auch im neuen Jahr zu schaffen. In einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA stuft ein Drittel (34 Prozent) der 1.021 befragten Mitgliedsunternehmen die eigene Auftragssituation mit Blick auf die nächsten sechs Monate als «großes» oder «sehr großes» Risiko ein.

Die Folge: Viele Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, ein Viertel sieht sich gezwungen, in den nächsten sechs Monaten Personal abzubauen.
In Summe bewertet jeder dritte Maschinen- und Anlagenbauer (35 Prozent) seine aktuelle Lage als «schlecht» oder «sehr schlecht». Zwar stuft immerhin jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) die Lage als «gut» oder «sehr gut» ein. Doch die Skepsis - auch mit Blick - nach vorn überwiegt.
«Unter dem Strich bewerten immer weniger Unternehmen die Lage als gut oder sehr gut», fasst VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers zusammen. «Der Standort Deutschland steht enorm unter Druck und überdies wird anderen Absatzregionen mehr Wachstum und damit Nachfrage nach Maschinenbauerzeugnissen zugetraut.»
Die künftige Bundesregierung müsse schnell Reformen auf den Weg bringen. Konkret fordert der VDMA:
- Einen international wettbewerbsfähigen Unternehmenssteuersatz von maximal 25 Prozent
- Einen Abbau von Bürokratie und Regulierung
- Eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
«Wir brauchen Anreize für Investitionen und niedrigere Kosten am Standort Deutschland», mahnt Wiechers. «Es braucht ein echtes Upgrade unseres Standorts.»
Seit Monaten macht die schwächelnde Konjunktur der Branche zu schaffen, die allein in Deutschland gut eine Million Menschen beschäftigt. Die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten wie China und den USA ist schwach, Handelskonflikte könnten sich ausweiten und die Lage noch verschärfen.
Für das Jahr 2025 erwartet die Branche den dritten Rückgang ihrer Jahresproduktion in Folge: Die preisbereinigte Produktion der Betriebe werde um weitere zwei Prozent sinken, heißt es in der jüngsten VDMA-Prognose.
(Text: dpa)
Tarifpoker gestartet - Öffentlicher Dienst vor Warnstreiks
Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kommen auf die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen Einschränkungen zu. Es werde sicher zu Warnstreiks und Protestaktionen kommen, teilte der Verhandlungsführer des Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, nach einer ergebnislosen ersten Tarifrunde in Potsdam mit. «Bund und Kommunen lassen uns keine andere Wahl.»

Den Arbeitgebern warf der Beamtenbund vor, die Verhandlungen zu verzögern. Das sei «nicht akzeptabel». Der dbb und die Gewerkschaft Verdi hatten bereits im Herbst auf einen harten Tarifkonflikt eingestimmt.
Direkt oder indirekt betroffen von den Verhandlungen sind laut Verdi mehr als 2,5 Millionen Menschen. Das Bundesinnenministerium spricht von 2,6 Millionen Beschäftigten bei den kommunalen Arbeitgebern und 132.000 Tarifbeschäftigten des Bundes. Sie arbeiten zum Beispiel in sozialen oder medizinischen Berufen, in der Verwaltung, an Schulen und Universitäten, im Nahverkehr oder in den Abfallbetrieben. Auch Feuerwehrleute und die Bundespolizisten gehören dazu.
Der Großteil ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt, auf Beamtinnen und Beamte wird der Tarifabschluss üblicherweise später übertragen. Für die Beschäftigten der Länder wird separat verhandelt.
Verdi und der Beamtenbund fordern acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. In besonders belastenden Jobs, etwa im Gesundheitsbereich mit Wechselschichten, soll es höhere Zuschläge geben.
Weitere Forderungen drehen sich um die Themen Arbeitszeit und Flexibilität. «Beim Geld allein wird die Privatwirtschaft den Staat immer abhängen, deshalb ist für die Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Dienstes auch ein Faktor wie Arbeitsplatzsouveränität entscheidend», sagte Geyer.
Die Gewerkschaften wollen für alle Beschäftigten drei zusätzliche freie Tage, für Gewerkschaftsmitglieder sollen es vier Tage sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zudem persönliche Arbeitszeitkonten erhalten. Damit sollen sie selbst entscheiden können, ob sie sich Überstunden auszahlen lassen oder diese zum Beispiel für zusätzliche freie Tage nutzen.
So reagieren die Arbeitgeber:
Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in Potsdam, sie erwarte einen Weg zum Kompromiss. Es müsse ein fairer Ausgleich gefunden werden, «zwischen den Interessen des öffentlichen Dienstes und dem notwendigen Respekt vor den Beschäftigten - und auf der anderen Seite aber auch vor den schwierigen Haushaltslagen». Nicht nur bei den Kommunen, sondern auch beim Bund sei die finanzielle Lage angespannt, betonte die SPD-Politikerin.
Sie sei dennoch zuversichtlich, dass eine «faire Lösung» möglich sei - wie bei der jüngsten Tarifrunde vor zwei Jahren. Es gebe diesmal ein großes Forderungspaket statt einzelner Forderungen der Gewerkschaften, sagte Faeser. «Das gibt sicherlich mehr Spielräume, auch für die Frage: "Wo trifft man sich am Ende?"» Gemeinsam mit Karin Welge (SPD), Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin und Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), führt Faeser die Verhandlungen auf Arbeitgeberseite.
Der Großteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist bei den Kommunen angestellt. Bei einigen von ihnen sind die Haushaltslöcher besonders groß. Welge mahnte an, dass die Zusatzkosten durch die Forderungen der Gewerkschaften nicht finanzierbar seien.
Verdi-Chef Frank Werneke übte in Potsdam deutliche Kritik am Investitionsstau in die Kommunen. Dieser betrage laut der KfW-Bank mittlerweile rund 18 Milliarden Euro. «Die Kommunen werden durch den Bund und die Länder systematisch und seit Jahren im Stich gelassen», sagte er. Gleichzeitig würden den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen.
Die Gewerkschaften warnten, viele Kommunen stünden vor einem Kollaps. Schon jetzt seien rund 500.000 Stellen unbesetzt. In den kommenden zehn Jahren gehen nach Angaben des Beamtenbundes weitere 1,4 Millionen Beschäftigte in den Ruhestand. «Es geht darum, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten», mahnte Werneke.
Die Gewerkschaften erwarten von Bund und Kommunen «konkrete Angebote», sagte Beamtenbund-Sprecher Geyer. «Wenn Frau Faeser und Frau Welge uns in den Verhandlungen nur immer wieder die Finanzkrise der Kommunen vorhalten, kommen wir hier keinen Schritt weiter.» Details zu möglichen Warnstreiks und Aktionen im öffentlichen Dienst wurden zunächst nicht bekannt.
Die zweite Verhandlungsrunde findet am 17. und 18. Februar und damit knapp eine Woche vor der Neuwahl des Bundestages statt. Die voraussichtlich finale Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März angesetzt.
(Text: Rabea Gruber, dpa)
Stellenabbau bei Miele ohne Kündigungen
Der Stellenabbau beim Hausgeräte-Hersteller Miele kommt ohne Kündigungen aus. Wie aus einer Mitteilung der Firma hervorgeht, haben in der laufenden Restrukturierung so viele Beschäftigte freiwillig das Unternehmen verlassen und dafür etwa Abfindungen bekommen, dass das Management betriebsbedingte Kündigungen nun ausschließt.

Man ziehe das ab sofort nicht mehr in Betracht, sagte das Miele-Geschäftsleitungsmitglied Rebecca Steinhage. Der notwendige Stellenabbau sollte so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden. «Das ist uns gelungen.»
Auch der Betriebsrat zeigte sich etwas erleichtert. «Befreit von der Sorge der betriebsbedingten Kündigungen gilt es jetzt, gemeinsam an der Zukunft aller Standorte zu arbeiten», sagte die Vorsitzende des Miele-Gesamtbetriebsrats, Birgit Bäumker. Miele hatte vergangenes Jahr angekündigt, dass etwa jede neunte der damals 11.700 Stellen in Deutschland wegfallen sollte - angepeilt war ein Abbau um 1300 bis 1400 Stellen. Vor allem Gütersloh war betroffen.
Die Firma ist unter Druck: Nach dem Boom in Corona-Zeiten, als die Menschen viel in ihre eigenen vier Wände investierten und dabei auch Küchengeräte, Waschmaschinen und Staubsauger kauften, schwächte sich die Nachfrage ab. 2023 sank der Umsatz auf rund fünf Milliarden Euro, 2022 waren es noch 5,4 Milliarden Euro. Jahreszahlen für 2024 wurden bislang nicht publiziert.
(Text: dpa)
DGB will für 15 Euro Mindestlohn kämpfen
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will für rund 15 Euro Mindestlohn in Deutschland kämpfen. «Wir halten an der Definition des armutsfesten Lohns, der bei 60 Prozent des Medianlohns liegt, fest», sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in Berlin.

Zu den Orientierungspunkten für die nächsten Verhandlungen in der Mindestlohnkommission muss nach den Worten von Körzell zählen, dass der armutsfeste Durchschnittslohn in Deutschland bei rund 14,80 Euro geschätzt werde. Das sei der Auftrag, dem sich die Kommission stellen müsse.
In der Kommission sitzen Spitzenvertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, auch Körzell ist dort vertreten. Der gesetzliche Mindestlohn war zum 1. Januar von 12,41 auf 12,82 Euro pro Stunde gestiegen. Körzell sagt: «Das ist nicht genug. Um in Zeiten der Inflation einen Mindestschutz zu gewährleisten, müsste der Mindestlohn bei circa 15 Euro liegen.» Auch SPD und Grüne wollen einen Mindestlohn 15 Euro. In der Mindestlohnkommission sollen die Sozialpartner anhand der vorangegangenen Tariflohnentwicklung einen Konsens über die weitere Anpassung der gesetzlichen Lohnuntergrenze im Grundsatz eigentlich ohne Eingreifen der Politik finden.
(Text: dpa)
EVG strebt frühen Bahn-Tarifabschluss an
Geht es nach der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), können Fahrgäste auf eine warnstreikfreie Tarifrunde bei der Deutschen Bahn hoffen. Beide Seiten treffen sich auf Wunsch der Gewerkschaft bereits am 28. Januar zur ersten Gesprächsrunde in Frankfurt.

Im besten Fall solle bereits in wenigen Wochen, noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar, eine Einigung stehen, sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay der Deutschen Presse-Agentur.
Bei der Deutschen Bahn hieß es, insbesondere für die jetzt gestartete Sanierung der DB seien Stabilität, Planbarkeit und Sicherheit sehr wichtig. «Auch mit Blick auf unsere Fahrgäste streben wir einen zügigen Abschluss an», teilte der bundeseigene Konzern mit. Die Forderungen der EVG lägen noch nicht vor.
Da der aktuelle Tarifvertrag und die damit einhergehende Friedenspflicht noch bis Ende März läuft, wären in dem angestrebten Zeitraum keine Arbeitskämpfe möglich. Ihre konkreten Forderungen will die Gewerkschaft am 23. Januar festlegen.
CDU will Bahn zerschlagen: Den engen Zeitplan begründet Ingenschay mit der anstehenden Bundestagswahl und den Ungewissheiten, die eine neue Regierung für die Bahn bedeuten würde. Die CDU etwa fordert schon lange eine Zerschlagung des bundeseigenen Konzerns, was die EVG strikt ablehnt.
«Unsere Kolleginnen und Kollegen dürfen angesichts immer lauterer Rufe nach Sparzwang und Bahn-Zerschlagung nicht zum Spielball der Politik werden», betonte Ingenschay. «Deshalb haben wir vorschlagen, die Tarifverhandlungen vorzuziehen, um schneller mehr Wertschätzung für harte Arbeit durchsetzen zu können.»
Hinzu komme die angespannte wirtschaftliche Situation beim Konzern. Es sei deshalb Planungssicherheit über Einkommen und Beschäftigung nötig. «Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen gute und verbindliche Lösungen zu erreichen. Ob dies gelingt, hängt entscheidend von der Verhandlungsbereitschaft des Arbeitgebers ab.»
Letzter Tarifvertrag wurde im Sommer 2023 geschlossen!
Zuletzt hatten sich EVG und DB im Sommer 2023 auf einen Tarifvertrag geeinigt. Demnach sollten 180.000 Beschäftigte unter anderem in zwei Stufen 410 Euro mehr pro Monat bekommen - bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Zudem sah der Tarifabschluss eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro vor.
Die Verhandlungen waren äußerst zäh. Zweimal legten die Gewerkschaftsmitglieder bei Warnstreiks die Arbeit nieder. Ein dritter Warnstreik wurde vom Arbeitsgericht in Frankfurt am Main verhindert. Letztlich brachte ein Schlichtungsverfahren mit Schlichterspruch das Ergebnis.
(Text: dpa)