Weiterhin keine Welle von Firmenpleiten in Sicht
Wiesbaden (dpa) - Die befürchtete Welle an Firmenpleiten zeigt sich nach wie vor nicht in der amtlichen Statistik. Mit 1029 Fällen lag die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im August des laufenden Jahres sogar um 2,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Freitag wurde auch das Niveau des nicht von der Corona-Krise beeinflussten August 2019 um 36,7 Prozent unterschritten.
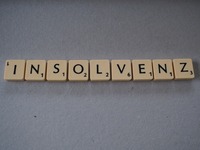
Um eine Pleitewelle in der Corona-Krise abzuwenden, hatte der Staat die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zeitweise ausgesetzt. Seit dem 1. Mai gilt die Insolvenzantragspflicht wieder vollumfänglich. Daher war mit einem Anstieg der Insolvenzen gerechnet worden. Ausnahmen gibt es noch für Betriebe, die im Sommer Schäden durch Starkregen oder Überflutungen erlitten haben.
«In den Zahlen für August 2021 ist, unter anderem aufgrund der Bearbeitungszeit bei den Gerichten, weiterhin keine Trendumkehr bei der Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu beobachten», stellten die Wiesbadener Statistiker fest. 9637 Firmenpleiten von Januar bis einschließlich August des laufenden Jahres waren 15,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), das monatlich einen Insolvenztrend veröffentlicht, sieht weiterhin «keine Insolvenzwelle in Sicht». Zwar seien die Zahlen im Oktober 2021 leicht gestiegen, sie lägen aber immer noch um 14 Prozent unter den bereits sehr niedrigen Werten aus dem Vorjahresmonat. «Unsere Frühindikatoren lassen allenfalls einen leichten Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen bis Ende des Jahres erwarten», sagte IWH-Forscher Steffen Müller Anfang dieser Woche.
Bei den Verbraucherinsolvenzen hingegen registrierte das Bundesamt im August einen kräftigen Anstieg: Diese schnellten im Jahresvergleich um 217,7 Prozent auf 5779 Fälle in die Höhe. Die Statistiker erklären diesen Sprung mit einer Gesetzesänderung, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, sich schneller von Restschulden zu befreien.
BMW-Werk Leipzig führt 35-Stunden-Woche ein
Die Arbeitszeiten im BMW-Werk Leipzig werden an die der bayerischen Werke angeglichen. «Bis 2026 wird die reguläre wöchentliche Arbeitszeit in drei Schritten um jeweils eine Stunde auf 35 Stunden reduziert», teilten Unternehmen und Betriebsrat am Freitag (5. November) mit. Um die Produktionskapazität zu halten, werden demnach bis 2026 zusätzlich 300 Mitarbeiter eingestellt.

BMW-Personalchefin Ilka Horstmeier sagte: «Wir schaffen gleiche Verhältnisse.» Die Verkürzung Arbeitszeit erfolge bei vollem Lohnausgleich. Zudem soll bis 2026 die Zahl der Auszubildenden erhöht werden. Die erste Stufe der Arbeitszeitverringerung erfolgt demnach zu Beginn des kommenden Jahres, die zweite 2024, und von Anfang 2026 an gilt in Leipzig die 35-Stunden-Woche. Das BMW-Werk im thüringischem Eisenach profitiert erst einmal nicht von dieser Regelung, weil es laut Horstmeier in einem anderen Tarifgebiet liegt und dort noch keine entsprechenden Verhandlungen geführt wurden.
Das Leipziger Werk ging 2005 in Betrieb und beschäftigt heute 5300 Mitarbeiter. Gesamtbetriebsratschef Manfred Schoch sagte, die Kürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden in der Woche bedeute rechnerisch einen Monat weniger Arbeit im Jahr.
BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte, der Stufenplan schaffe Planungssicherheit und stelle die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sicher. «Dafür steht auch der Ausbau der Produktion für Elektroantriebskomponenten und die Erweiterung der Leipziger Produktpalette um den vollelektrischen Nachfolger des Mini Countryman.» Bisher rollen in Leipzig täglich rund 1100 Fahrzeuge der kleinen Modellreihen BMW 1er und 2er und des Elektropioniers i3 vom Band.
Der Konkurrent Volkswagen will nach eigenen Angaben bis 2026 schrittweise die 35-Stunden-Woche in seinen Werken in Zwickau, Chemnitz und Dresden einführen, die VW-Tochter Porsche in seinem Werk in Leipzig schon 2025.
(Text: dpa)
Hunderte Beschäftigte bei Warnstreiks an drei NRW-Unikliniken
Mehrere hundert Tarifbeschäftigte der drei Universitätskliniken in Essen, Düsseldorf und Köln haben am gestrigen Dienstag (9. November) in Nordrhein-Westfalen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Mit Warnstreiks, zu denen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, verliehen sie ihren Forderungen in den bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder Nachdruck und demonstrierten für höhere Löhne.

Nach Angaben einer Verdi-Sprecherin beteiligten sich insgesamt etwa 1300 Menschen an den Warnstreiks. Um die Versorgung der Patientinnen und Patienten insbesondere auf den Intensivstationen nicht zu gefährden, hatte Verdi für die Dauer der Streikmaßnahmen in der Pandemie «Notdienstvereinbarungen» mit den Kliniken getroffen. Auch in Berlin traten zahlreiche Landesbeschäftigte in den Warnstreik, darunter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landeseigener Kitas, der Bezirksämter sowie Sozialarbeiter.
Mehrere Gewerkschaften verhandeln seit rund vier Wochen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die jüngste Verhandlungsrunde war Anfang November ohne Einigung beendet worden. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Auszubildende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die TdL wies die Forderungen als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden.
(Text: dpa)
3G am Arbeitsplatz?
Auf Ungeimpfte kommen verschärfte Regeln am Arbeitsplatz zu. SPD, Grüne und FDP planen 3G - das bedeutet: Nur wer geimpft oder genesen ist oder einen tagesaktuellen Test vorweist, soll künftig zur Arbeit gehen können. Viele wesentliche Fragen allerdings sind noch ungelöst.

Was ist geplant?
Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz, die weder eine Impfung noch einen Genesenen-Status haben, sollen sich künftig täglich auf Corona testen lassen müssen. Diese allgemeine 3G-Regel am Arbeitsplatz soll dabei helfen, die neue Pandemie-Welle zu brechen. Verankert werden soll die neue Vorgabe voraussichtlich im Bundes-Infektionsschutzgesetz. Sie soll flankiert werden durch die Wiedereinführung kostenloser Corona-«Bürgertests».
Was genau ist zu den Tests geplant?
Bisher müssen Arbeitgeber laut Arbeitsschutzverordnung allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens zweimal in der Woche Corona-Tests anbieten. Es gibt aber keine Testpflicht für Mitarbeiter. Künftig sollen nun tägliche Tests Voraussetzung sein für Ungeimpfte, damit sie zu ihrem Arbeitsplatz dürfen - oder für Arbeitnehmer, die nicht nachweisen wollen, ob sie geimpft oder genesen sind. Wer diese täglichen Tests finanziert, wenn Mitarbeiter nicht vor Arbeitsbeginn einen künftig wieder kostenlosen «Bürgertests» machen, ist offen.
Offen ist, ob der Arbeitgeber zumindest zeitweise erfahren können soll, welche Beschäftigten geimpft sind. Bisher können nur Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Fragerecht für alle Branchen und Betriebe gefordert.
Was sind mögliche Folgen bei Verstößen?
Was passiert, wenn Beschäftigte einen täglichen Test verweigern oder nicht vorlegen - und dann nicht an den Arbeitsplatz können? Können sie dann freigestellt werden oder müssen sie andere Folgen befürchten? Das ist eine wesentliche Frage, die noch nicht gelöst ist. Offen ist auch, was passiert, wenn Arbeitgeber bei Kontrollen nicht die erforderlichen Unterlagen vorweisen können.
Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, hält es für vorstellbar, dass diejenigen, die sich Tests verweigern, mit einer Abmahnung oder gar im Wiederholungsfall mit einer Kündigung rechnen müssen. Die Weigerung könnte als Pflichtverstoß gewertet werden.
Was fordern Arbeitgeber?
Eine 3G-Regel am Arbeitsplatz mache nur mit einem Auskunftsrecht Sinn, betonte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Und: Komme der Arbeitnehmer seiner Nachweispflicht nicht nach, werde er vielfach nicht mehr beschäftigt werden können. «Es gilt dann der Grundsatz: Ohne Leistung kein Lohn. Nur so lässt sich der innerbetriebliche Gesundheitsschutz effektiv gewährleisten.»
Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, forderte, dass die Kosten für die Tests nicht auf die Firmen abgewälzt werden dürften. «Ansonsten droht eine organisatorische und auch finanzielle Überforderung vieler Arbeitgeber.» Die Tests müssten vom Staat bezahlt werden. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hofft darauf, dass es mit einer bundeseinheitlichen Regelung mehr Rechtssicherheit und Klarheit geben könnte. «Das erhöht die Akzeptanz der Maßnahmen durch die Mitarbeiter», so Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Die bisherige Rechtslage sei verwirrend.
Was sagen Gewerkschaften?
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann sagte, aufgrund der derzeit «eskalierenden Infektionslage» sei wirksamer Schutz vor Infektionen am Arbeitsplatz wichtiger denn je: «Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen des Arbeitsschutzes können 3G-Zugangsregeln am Arbeitsplatz hierfür ein wirksames Mittel sein. Die Kosten für die Tests muss weiterhin der Arbeitgeber tragen und das Testen muss Teil der vergütungspflichtigen Arbeitszeit sein.»
Beschäftigte am Arbeitsplatz müssten bestmöglich vor Infektionen geschützt seien. Zugleich aber dürfe nicht unverhältnismäßig in die Grundrechte der Beschäftigten eingegriffen werden. Der DGB lehne deshalb eine Auskunftspflicht von Beschäftigten über den eigenen Corona-Impfstatus ab, so Hoffmann. «Gleichwohl empfehlen wir den Beschäftigten, ihren Impfstatus freiwillig offenzulegen.»
Was ist mit einer 2G-Regel am Arbeitsplatz?
Das ist bisher nicht geplant. Rechtsanwalt Meyer hält die Umsetzung einer generellen 2G-Regelung am Arbeitsplatz in Deutschland für besonders schwierig. «Eine solche Regelung würde bedeuten, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr arbeiten dürfte, wenn er von seinem Recht Gebrauch machen würde, sich nicht impfen zu lassen.» Insofern würden mit 2G am Arbeitsplatz indirekt Beschäftigungsmöglichkeiten «gekappt», was in vielen Fällen unverhältnismäßig wäre.
(Text: Andreas Hoenig, Basil Wegener und Amelie Breitenhuber, dpa)
Politik muss mehr tun gegen Corona - 3G am Arbeitsplatz
Die Wirtschaft schlägt wegen der steigenden Corona-Zahlen Alarm. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft verlangte, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen. Industriepräsident Siegfried Russwurm forderte Bund und Länder auf, deutlich mehr zu tun. «Die Politik droht den gleichen Fehler zu machen wie im Herbst vorigen Jahres, als die Politik vor konsequenten und zentral wirksamen Maßnahmen zurückschreckte», sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur.

«Bund und Länder müssen rasch gemeinsam eine klare bundesgesetzliche Grundlage schaffen, damit die Unternehmen in den kommenden Wochen Schutzmaßnahmen auf 3G-Basis nachvollziehbar und planvoll für ihre Mitarbeitenden anwenden können», sagte Russwurm. «So lassen sich Arbeitsabläufe wieder weitestgehend normalisieren, die Beschäftigten von belastenden Hygienevorgaben befreien, und kreative Zusammenarbeit wird wieder uneingeschränkt möglich.»
Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft sagte der dpa, ein gesetzlich geregelter Abfrageanspruch der Arbeitgeber über den Impfstatus ihrer Beschäftigten würde dringend gebotene Rechtssicherheit schaffen. «Entscheidend ist, dass die Geschäftsabläufe in den Betrieben, die unter den Folgen von Pandemie und Lockdown leiden, nicht gestört werden oder gar zum Erliegen zu kommen», so Jerger. Er appelliere dringend an Beschäftigte, sich impfen oder regelmäßig testen zu lassen. «Ein weiterer Lockdown, selbst wenn dieser auch nur regional begrenzt wäre, könnte für die betroffenen Unternehmen das Ende bedeuten.»
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte einen zeitnahen Impfgipfel. Es sei eine klare und eindeutige Grundlage für die Fortentwicklung von betrieblichen Schutzkonzepten nötig, sagte Dulger . Das Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impf- oder Genesenenstatus müsse endlich gesetzlich festgelegt werden. «Wer da zögert, riskiert ein Weniger an Gesundheitsschutz in unseren Betrieben.»
Bisher können nur Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Fragerecht für alle Branchen und Betriebe gefordert.
Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sagte weiter: «Ob 2G oder 3G: Welche Regelungen für Betriebe praktikabel sind, muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Wie so oft gilt die Praxisregel: Betriebe vor Ort wissen am besten, was sinnvoll für ihre Beschäftigten und den Betrieb ist.»
Russwurm kritisierte, die Entscheidung über eine Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sei das falsche Signal: «Angesichts rasant steigender Infektionszahlen wird es dem Ernst der Lage nicht gerecht, öffentlich den bevorstehenden Normalzustand anzudeuten», sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie.
SPD, Grüne und FDP, die über eine neue Regierung verhandeln, wollen die Rechtsbasis für drastische Corona-Einschränkungen wie Ausgangssperren zum 25. November auslaufen lassen. Bis zum Frühjahr sollen den Ländern weniger umfassende Vorgaben möglich sein.
Russwurm kritisierte, es sei falsch, dass die Bundesregierung gerade jetzt die Verantwortung für ein koordiniertes Krisenmanagement an die Bundesländer delegieren wolle. «Anstatt mit einer länderübergreifenden Steuerung und konsequenten Eindämmungskonzepten die Welle zu brechen, droht erneut ein ineffizienter Flickenteppich uneinheitlicher Ländermaßnahmen.»
Die Gewerkschaft IG Metall warnte vor dem Anfang einer neuen Infektionswelle in Betrieben. Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban sagte, die Corona-Arbeitsschutzverordnung sei an die epidemische Lage von nationaler Tragweite gekoppelt. Sollte diese nicht verlängert werden, würden auch Regelungen zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz entfallen. Betriebliche Schutzmaßnahmen würden in der Breite aber häufig erst dann umgesetzt, wenn es rechtliche Verpflichtungen dazu gebe, wie etwa im Fall von Testangeboten durch die Arbeitgeber.
Russwurm sagte, die Politik müsse alles daran setzen, dass die Impfzahlen weiter steigen und Auffrischungsimpfungen systematisch durchgeführt werden. Die Länder seien gefordert, jetzt ihre Impfzentren zu reaktivieren, wenn die Impfkapazitäten in Arztpraxen für ein rasches Auffrischen nicht ausreichten.
«Es darf nicht sein, dass eine kleine Gruppe von Impfverweigerern in den kommenden Monaten eine ganze Gesellschaft mit mehrheitlich Geimpften lähmt», sagte der Industriepräsident. «Es ist allerhöchste Zeit, über eine Impfpflicht für alle Berufstätigen mit regelmäßigen Kontakten zu vulnerablen Gruppen in Pflegeheimen, Schulen und Kitas nachzudenken.»
Angesichts sprunghaft steigender Inzidenzen drohten in den kommenden Wochen Schließungen von Schulen und Kindergärten, so Russwurm. «Neben den negativen Auswirkungen für die Kinder ergeben sich daraus für Beschäftigte, die auf eine funktionierende Kinderbetreuung angewiesen sind, empfindliche Auswirkungen, die wir im vergangenen Winter erleben mussten.»
(Text: Andreas Hoenig, dpa)
Beschäftigte rüsten sich für Warnstreiks im öffentlichen Dienst
Die Menschen in Deutschland müssen sich innerhalb der kommenden drei Wochen auf verstärkte Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder einstellen. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für mehr als eine Million Beschäftigte sprach Verdi-Chef Frank Werneke am gestrigen Dienstag (2. November) in Potsdam von einem «absolut enttäuschenden Verhandlungstag». Zunächst sollen nach Gewerkschaftsangaben vor allem Gesundheitswesen, Justiz und Straßenbauverwaltung von den Ausstände betroffen sein.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), wies die Forderungen erneut als unrealistisch zurück: «Wir sind in der Tat weit auseinander.» Der öffentliche Dienst solle weiter leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben. «Auf der anderen Seite haben wir aber große Herausforderungen, unsere Haushalte zu schließen.» Dennoch sprach Hilbers von «konstruktiven» Gesprächen.
Die Sicht der Gewerkschaften hingegen könnte nicht gegensätzlicher sein. «Zu allen Forderungen der Gewerkschaften haben Sie unisono Nein gesagt, zu keinem einzigen Thema sind sie verhandlungsbereit», sagte Werneke. Besonders empörend sei die Ablehnung der besonderen Belastungssituation, die es derzeit im Gesundheitswesen gebe. «Da sind wir wirklich an einem Tiefpunkt der Verhandlungen», sagte Werneke. Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sagte: «Das waren zwei verlorene Tage und wenn die Finanzminister der Länder so weiter machen, fahren sie die Verhandlungen komplett vor die Wand.»
Wann und in welchem Umfang die Beschäftigten ihre Arbeit genau niederlegen werden, teilten die Gewerkschaften zunächst nicht mit. Mit den bundesweit geplanten Aktionen wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 27. und 28. November erhöhen. Betroffen von einem Abschluss sind auch 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte sowie rund eine Million Versorgungsempfänger, auf die ein Ergebnis übertragen werden soll.
Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, betonte, Lehrkräfte, Lehrende an Hochschulen, Erzieherinnen und Erzieher und Sozialpädagogen erwarteten eine ordentliche Gehaltssteigerung. Die Gewerkschaften begründen ihre Forderungen unter anderem mit der starken Inflation. Die Frauen und Männer in der Pflege und anderen Gesundheitsberufen sollen angesichts der Belastungen durch die Corona-Krise besonders berücksichtigt werden.
Vor dem bisher letzten Länder-Tarifabschluss waren vor zwei Jahren etwa Schulen, Berufsschulen, Landeskliniken, Kitas und Ämter mit Warnstreiks teils lahmgelegt worden.
(Text: dpa)
Investitionsrunde der Irritationen bei Volkswagen
War es eine neue Provokation? Oder ein überfälliger Weckruf? Rund um Aussagen von Vorstandschef Herbert Diess über angeblich 30 000 gefährdete Stellen brandete jüngst wieder die konzerntypische Erregungswelle bei Volkswagen auf. Präziser gesagt: um den genauen Bezug seiner Gedanken in einer Aufsichtsratssitzung

Manche fürchten, dass Europas größter Autobauer durch Kostendruck, Chipkrise und die wachsende Marktmacht des US-Rivalen Tesla abermals viele Jobs kappen muss. Das Management versicherte, es gebe keinerlei konkrete Pläne, erst recht keine Streichliste. Andere glauben: Diess' Äußerungen könnten als Testballon für mögliche weitere Sparpakete dienen - auch wegen darauffolgender Warnungen an Top-Führungskräfte, man dürfe beim Umbau der Autoindustrie nicht den Anschluss verpassen.
So oder so würde das Timing passen: In drei Wochen (12. November) sollen in Deutschlands größtem Unternehmen die Entscheidungen zu den Investitionen der kommenden fünf Jahre stehen. Der Planungsrunde zur Belegung der Werke und Verteilung der Milliarden auf einzelne Themen waren schon oft Feilschen und Finten vorausgegangen. Und natürlich geht es auch um Jobs, die an bestehenden und neuen Modellen hängen.
Diesmal ist die Gemengelage besonders delikat. Wann wieder ausreichend Halbleiter da sind, um die größtenteils weiterlaufende Kurzarbeit einzudämmen, ist unklar. Ebenso die Frage, wie groß die Folgen von Teslas «Gigafabrik» bei Berlin für den Automarkt sein werden, quasi direkt vor der Haustür des VW-Stammsitzes Wolfsburg.
Um Wolfsburg ging es denn auch bei den neuesten Irritationen. Im September hatte Diess in einer Aufsichtsratsrunde die Zahl 30 000 genannt - wie er später betonen ließ, aber als Extremszenario, falls der Umbruch in Richtung E-Mobilität nicht so vorankomme wie erhofft.
Klar ist: Das VW-Hauptwerk ist inzwischen arg unterausgelastet, 2021 könnte hier so wenig produziert werden wie zuletzt Ende der 1950er Jahre. Aus derzeitiger Sicht dürfte es schwer sein, überhaupt die knappe halbe Million des harten Corona-Jahres 2020 noch zu schaffen.
Der Betriebsrat ist alarmiert. Er verlangt schon länger ein weiteres Elektromodell neben dem Projekt «Trinity», das ab 2026 kommen soll - später als zunächst geplant. Womöglich hat Wolfsburg bei der ID-Reihe auch Chancen für eine Gemeinschaftsproduktion mit anderen Werken.
Selbst wenn der Vorstoß von Diess nicht als Einstimmung auf drohenden Jobabbau erscheinen sollte: Teilnehmer der Sitzung fragen sich, warum der gerade mit einem frischen Vertrag ausgestattete Chef schon wieder derart voranpreschte. Dass VW vor allem bei der Kernmarke die Kosten drücken muss, weiß eigentlich jeder.
Auf den Ende 2016 vereinbarten «Zukunftspakt», der Kürzungen bei parallelem Aufbau neuer Beschäftigungsfelder vorsah, folgte die «Roadmap Digitale Transformation». Ende vorigen Jahres vereinbarten Management und Betriebsrat, dass die Fixkosten der Marke VW bis 2023 um fünf Prozent sinken sollen. Gleichzeitig soll die Rendite zulegen. Die Personalausgaben werden zudem - im Rahmen schon laufender Programme - durch Vorruhestand, Altersteilzeit oder Einstellungsstopps gedrückt.
Mag sein, dass VW da angesichts von Pandemiefolgen, Teilemangel und Transformationsdruck noch einmal nachsteuern muss. Aber warum, so fragen sich einige, kommt das Reizthema in dieser Form jetzt schon wieder so schnell aufs Tapet?
Hier die Macher, dort die Blockierer - diese Konfliktlinie zwischen dem Vorstand und Teilen des Kontrollgremiums war lange die gängige Erzählung in Wolfsburg. Gerade wenn heikle Entscheidungen vorbereitet werden mussten. Nach dem Wechsel des langjährigen Betriebsratschefs Bernd Osterloh in den Vorstand der Nutzfahrzeug-Tochter Traton im Mai sowie der von Diess forcierten, eigenen Vertragsverlängerung im Juli dachten manche, es werde nun etwas ruhiger und harmonischer.
Weit gefehlt, könnte man meinen. Osterlohs Nachfolgerin Daniela Cavallo hatte zwar angekündigt, genauso entschieden für die Belange der Belegschaft einzutreten. Und Diess hatte erklärt, sich auf die Zusammenarbeit mit ihr zu freuen. Nun verlautete aus Konzernkreisen jedoch, es habe ausgerechnet vor dem Durchrechnen möglicher Sparziele keine Abstimmung mit der Mitarbeitervertretung gegeben. Danach noch das Poltern im Aufsichtsrat - also alles beim Alten? «Es gibt keine Gedankenspiele über irgendeinen Arbeitsplatzabbau», stellte Cavallo klar - und forderte Diess ebenso zu einer Klarstellung auf.
Das Wort Vertrauensbruch will offiziell niemand in den Mund nehmen. Doch alle Beteiligten wissen, dass für VW in den nächsten Jahren sehr viel auf dem Spiel steht und deshalb alle an einem Strang ziehen sollten. Diess ist bekannt für seine ruppige Art, mit der er selbst kokettiert. Der Einschätzung vieler Branchenexperten, kaum jemand sei bei der Zukunftsplanung auch inhaltlich so mutig wie er, tut das aber keinen Abbruch. In der Industrie ist sein Umsteuern hoch angesehen.
«Ich habe, wenn ich an Wolfsburg denke, nicht den Abbau von Arbeitsplätzen im Kopf», sagte er intern. «Mir geht es darum, wie wir miteinander arbeiten. Wir brauchen eine neue Denkweise.» Dabei müsse sich auch Wolfsburg strecken. In einem VW-Papier an die potenziellen Koalitionäre im Bund heißt es: «Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass Europa bis 2050 treibhausgasneutral wird.» Um den Bedarf an mehr Agilität lasse sich nicht herumreden, so Diess. In der Sache völlig unstrittig, sagt jemand aus der Eigentümerschaft. Unabgesprochenes Vorgehen werde man aber nicht mittragen. «Damit käme er nicht durch.»
Wie schmerzhaft die Umwälzungen in der deutschen Kernbranche werden könnten, wissen längst auch die VW-Beschäftigten. Zu den wiederholten Ränkespielen gibt es aber teils Kopfschütteln. Man habe gedacht, die ständige Nabelschau an der Spitze werde jetzt einmal aufhören, sagt einer. Stattdessen sollten sich die Chefs doch bitte um die akuten Probleme kümmern - Stichwort Bänderstopp durch fehlende Halbleiter. VW hat zwar seit Monaten eine Taskforce, die noch möglichst viele Chips auftreiben soll. Aber auch Cavallo wird hier zusehends nervös.
«Von der Führung eines Weltkonzerns darf man schon erwarten, in der Lage zu sein, den Einkauf so zu organisieren, dass verlässlich Autos gebaut werden», sagte die neue Betriebsratschefin «Zeit online». Aus der Leitung sei noch kein Plan erkennbar, «wie diese Krise gemanagt werden kann. Im ersten Halbjahr machen wir einen Rekordgewinn, und jetzt wird über den Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen spekuliert.»
Ob manche Markenzahlen im dritten Quartal womöglich rot ausfallen, zeigen die nächsten Wochen. Nicht gerade hilfreich erscheint da aus der Perspektive der Wolfsburger Werker, dass Diess wieder mal als wenig nahbar erscheint. Eine Einladung zur nächsten Betriebsversammlung in der Zentrale am 4. November habe er abgesagt. Grund: ein Termin bei US-Investoren.
(Text: Jan Petermann, dpa)
Besserer Schutz von Saisonarbeitern
Die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hat eine bessere soziale Absicherung von Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft verlangt. «Die permanenten massiven Arbeitsrechtsverletzungen in der Saisonarbeit müssen endlich aufhören», erklärte der IG BAU-Vize Harald Schaum am 22. Oktober bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021 der Initiative Faire Landarbeit. Nach Einschätzung der Gewerkschaft waren auch im laufenden Jahr wieder rund 274 000 Wanderarbeiter bei den verschiedenen Ernten in Deutschland eingesetzt.

In dem Bericht sind zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen die meist aus Osteuropa stammenden Menschen mit diversen Methoden um ihren gerechten Lohn gebracht wurden. Mangelhafte Unterkünfte, für die teils überhöhte Mieten verlangt wurden sowie unzureichende Corona-Schutzmaßnahmen sind weitere häufige Mängel, die bei den Betriebsbesuchen der Initiative aufgefallen sind. Die teils verhängte strenge Arbeitsquarantäne barg zudem laut Schaum ein hohes Missbrauchspotenzial, weil die Beschäftigten damit praktisch an einen Betrieb zwangsgebunden gewesen seien.
DGB-Vorständin Anja Piel kritisierte die während der Pandemie auf 102 Tage verlängerte Zeit, in der Saisonkräfte ohne Sozialversicherung beschäftigt werden durften. Die nächste Regierungskoalition müsse die «Ausbeutung auf deutschen Feldern» beenden, erklärte die Gewerkschafterin. «Die sozial nicht abgesicherte kurzfristige Beschäftigung muss in allen Branchen auf wenige Tage im Jahr begrenzt werden.» Staatliche Kontrollen müssten ausgeweitet und Arbeitszeit verlässlich erfasst werden. Zudem sollten die Arbeitgeber die Kosten für menschenwürdige Unterkünfte tragen.
Die ab dem kommenden Jahr geltende Nachweispflicht einer Krankenversicherung reiche nicht aus, sagte Katharina Varelmann von der Initiative Faire Landarbeit. Sie rechne damit, dass viele Arbeitgeber private Gruppenversicherungsverträge mit unklarem Leistungsumfang abschließen werden. Die Arbeitnehmer hätten so aber keinen direkten und vom Arbeitgeber unabhängigen Zugang zu den Leistungen.
(Text: dpa)
Jeder Achte fürchtet wegen Digitalisierung um eigenen Job
Etwa jeder achte Arbeitnehmer in Deutschland fürchtet einer neuen Erhebung zufolge wegen der anhaltenden Digitalisierung in der Arbeitswelt um den eigenen Job. Zwölf Prozent der Befragten äußerten in einer Jobstudie des Beratungsunternehmens EY Sorgen, dass ihr Arbeitsplatz infolge neuer technologischer Entwicklungen künftig in Gefahr geraten könnte. 88 Prozent der Befragten führten in dieser Hinsicht dagegen keine Bedenken an. Die Studie lag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am gestrigen Montag (25. November) vor.

EY führt Umfragen dieser Art in regelmäßigen Abständen durch. Auffällig: Vor zwei Jahren, also vor der Corona-Pandemie, lag der Anteil der wegen der Digitalisierung um den eigenen Job besorgten Arbeitnehmer mit 13 Prozent sogar noch leicht höher. Vor vier Jahren (7 Prozent) war die Unsicherheit aber deutlich geringer ausgeprägt.
Bricht man die Frage nach technologisch begründeten Job-Ängsten auf einzelne Wirtschaftsbereiche herunter, stechen vor allem die Banken-, Immobilien- und Versicherungsbranche heraus. Jeder fünfte in diesem Bereich Beschäftigte (20 Prozent) macht sich wegen des technologischen Fortschritts Sorgen um den eigenen Job. In der Autoindustrie sind es 19 Prozent, im Maschinen- und Anlagenbau immerhin 17 Prozent. Im Vergleich eher wenig Bedenken haben beispielsweise Arbeitnehmer aus dem Gesundheitsbereich (8 Prozent).
Immerhin mehr als jeder dritte Beschäftigte (36 Prozent) gab an, neue Technologien hätten in der Vergangenheit schon Teile der eigenen Arbeit ersetzt - jeder zwanzigste Angestellte sprach hier sogar von einem «erheblichen Umfang». Runtergebrochen auf Wirtschaftsbereiche äußerten auch hier Arbeitnehmer aus der Banken-, Immobilien- und Versicherungsbranche (46 Prozent) am häufigsten, dass geringfügige oder erhebliche Teile ihrer einstigen Arbeit inzwischen technisch ersetzt worden seien. Dahinter folgen der Bereich Telekommunikation/IT (42 Prozent) sowie die Autoindustrie (40 Prozent).
(Text: dpa)
Mehr als 56 600 Strafrechts-Ermittlungen wegen Schwarzarbeit
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zoll hat im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 56 600 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten eingeleitet. Bei 1715 dieser Verfahren ging es um die Unterschreitung des Mindestlohns, wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup hervorgeht. Zuvor hatte die Funke-Mediengruppe berichtet. Die Zahlen liegen in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Von den Verfahren entfielen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 2800 auf die Baubranche. Im Zusammenhang mit nichtgezahlten Mindestlöhnen ermittelte der Zoll dort in rund 450 Fällen. Insgesamt geht es bei den Ermittlungen der Finanzkontrolle um Schäden in Höhe von rund 457,2 Millionen Euro allein im ersten Halbjahr.
Der Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, forderte wirkungsvollere Maßnahmen gegen solche Straftaten. «Die tatsächlichen Zahlen dürften weitaus höher sein. Mindestlohnbetrug ist nach wie vor an der Tagesordnung», teilte er am Montag mit. «Ein stärkerer Kontrolldruck und eine größere Abschreckungswirkung sind hier erforderlich – im Interesse der Beschäftigten, aber auch im Interesse der ehrlichen Unternehmen.»
(Text: dpa)