Moderne Laborberufe im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung schreitet auch in der Chemie- und Pharmaindustrie weiter voran. Aus diesem Grund hat nach der Modernisierung des Ausbildungsberufs »Chemikant/Chemikantin« im Jahr 2018 das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) gemeinsam mit den zuständigen Bundesministerien sowie den Sozialpartnern und Sachverständigen aus der betrieblichen Praxis im Auftrag der Bundesregierung nunmehr auch die »Verordnung über die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack» entsprechend überarbeitet. Sie umfasst die drei Laborberufe Biologielaborant/-in, Chemielaborant/-in und Lacklaborant/-in. Die neuen Regelungen treten am 1. August 2020 in Kraft.

Wesentlichste Neuerung sind zwei speziell auf die Ausprägung digitaler Kompetenzen ausgerichtete Wahlqualifikationen: »Digitalisierung in Forschung, Entwicklung, Analytik und Produktion« sowie »Arbeiten mit vernetzten und automatisierten Systemen«. Dabei bündelt die neue Wahlqualifikation »Digitalisierung in Forschung, Entwicklung, Analytik und Produktion« beispielsweise alle Kompetenzen, die für die Arbeit in einer digitalen Laborumgebung notwendig sind. Dies reicht vom Arbeiten in virtuellen Teams oder dem Durchführen von Simulationen über das Erfassen, Prüfen und Auswerten von Daten bis hin zum Einhalten rechtlicher und betrieblicher Vorgaben zum Schutz und zur Sicherheit digitaler Daten.
Bei der neuen Wahlqualifikation »Arbeiten mit vernetzten und automatisierten Systemen« geht es um das Einrichten, Prüfen und Optimieren von Labormanagement- und Laborinformationssystemen sowie die Arbeit mit diesen digitalen Technologien. Dies beinhaltet auch das Erkennen von Störungen und das Einleiten von Maßnahmen zu deren Beseitigung.
Die digitalen Wahlqualifikationen stellen vor allem für die Ausbildungsbetriebe neue Optionen dar, die in der Digitalisierung von Arbeitsumgebungen schon fortgeschritten sind und ihren Auszubildenden eine entsprechende Schwerpunktsetzung ermöglichen wollen. Die Mindestanforderungen an die Laboranten-Ausbildung werden durch die Änderungsverordnung nicht erhöht. Ebenso bleibt die bewährte Struktur der Ausbildungsordnungen erhalten.
Bundesweit wurden in den drei Ausbildungsberufen im Jahr 2019 insgesamt 2.277 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, wobei der weitaus größte Teil (rund 73 Prozent) auf den Bereich der Chemielaborantinnen beziehungsweise -laboranten entfällt. Im Anschluss an die Ausbildung besteht die Möglichkeit, Aufstiegsfortbildungen zu absolvieren, zum Beispiel zum/zur Industriemeister/Industriemeisterin Chemie.
Die jetzt modernisierten Ausbildungsordnungen und die darauf abgestimmten, von der Kultusministerkonferenz (KMK) für den schulischen Teil der dualen Ausbildung entwickelten Rahmenlehrpläne treten zum 1. August 2020 in Kraft.
Weitere Informationen im Internetangebot des BIBB unter www.bibb.de/neue-berufe
Längerer Lohnersatz bei geschlossener Schule und Kita
Berlin (dpa) - Der Staat will Eltern, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht zur Arbeit können, länger als bisher Lohnersatz zahlen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine entsprechende Ausweitung der geltenden Regelung auf den Weg gebracht, die Ende März wegen der Corona-Pandemie beschlossen worden war.
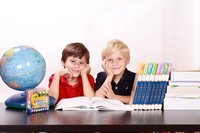
Die Verdienstausfallentschädigung soll künftig pro Elternteil für maximal zehn Wochen statt wie bisher sechs Wochen gezahlt werden. Alleinerziehende Eltern sollen sogar Anspruch auf bis zu 20 Wochen Entschädigung haben, kündigte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im ZDF-«Morgenmagazin» an. «Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um finanzielle Sicherheit zu geben», sagte sie. Die SPD hatte sich in der Koaltion dafür schon länger eingesetzt. Zum Wochenbeginn hatten sich auch CDU und CSU dafür ausgesprochen. Die Änderungen müssen noch durch Bundestag und Bundesrat.
Bisher galt: Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann und deshalb kein Geld verdient, erhält bisher für maximal sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens als Entschädigung, höchstens 2016 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt das Geld aus und kann es sich von den Behörden erstatten lassen.
Weil viele Kitas und Schulen voraussichtlich noch längere Zeit nicht in den Regelbetrieb gehen können, soll nun die Zahldauer des Lohnersatzes verlängert werden. Nachdem mehrere Medizinerverbände am Dienstag eine sofortige Öffnung der Einrichtungen gefordert hatten, wird aber verstärkt auch über eine schnellere Rückkehr zum Schul- und Kitaregelbetrieb diskutiert.
Corona-Lockerungen: Gastgewerbe erlebt durchwachsenen Auftakt
Der Neustart im Gastgewerbe bleibt nach der wochenlangen Corona-Zwangspause durchwachsen. Zu den ersten Tagen mit wieder geöffneten Restaurants und Cafés sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, «natürlich hat es gerade jetzt an dem durchaus sonnigen Wochenende viele Menschen nach draußen gezogen». Vor allem die Außengastronomie habe davon profitiert. «Doch noch sind viele Gäste verhalten», sagte sie am Montag. Die Lockerungen in der Corona-Krise für den Tourismus wurden vielerorts gut angenommen.

Auch aufgrund der Abstandsgebote hätten die Unternehmen in der Gastronomie deutlich niedrigere Umsätze im Vergleich zum Vorjahr, sagte Hartges. Der Neustart für die niedersächsische Gastronomie etwa sei ernüchternd verlaufen. Bei Lokalen mit eigenem Essensangebot, die schon Anfang vergangener Woche öffnen durften, hätten die Erlöse einer Umfrage zufolge lediglich rund 25 Prozent der Vorjahreswerte erreicht.
Für Betriebe und Gäste in Restaurants sei die Umsetzung ein Lernprozess, sagte Hartges. «In den Lokalen gibt es natürlich Bewegung. Wenn Sie nach zwei Monaten endlich ihre Bekannten wiedersehen, dann gehen Sie auch auf die Tische zu.» Vermehrte Einsätze der Ordnungsämter und der Polizei etwa in NRW seien daher nicht überraschend. Hartges rief erneut Gastronomen und Gäste dazu auf, sich an die Regeln zu halten. «Nur, wenn alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden, werden wir dauerhaft die Öffnung sichern», sagte sie.
Während in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen schon seit gut einer Woche einige Gastronomiebereiche wieder öffnen dürfen, sind andere Bundesländer wie Berlin und Brandenburg erst später nachgezogen. Seit diesem Montag besteht in sämtlichen Ländern die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen zumindest einen Teil der Gastrobranche wieder zu öffnen.
In Hamburg, Hessen, Sachsen, Thüringen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Schleswig-Holstein sind zudem Hotels und Ferienwohnungen wieder geöffnet. Außer in Bayern ist das in den restlichen Ländern zumindest für Ferienwohnungen erlaubt.
In Schleswig-Holstein waren bereits am frühen Montagmorgen viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg unterwegs. Und auch am Fähranleger Richtung Föhr und Amrum sowie an der Autoverladestation nach Sylt in Niebüll selbst herrschte reger Betrieb.
Campingplatzbetreiber aus Nordrhein-Westfalen berichteten von einem ungewöhnlichen Ansturm für das anstehende lange Himmelfahrts-Wochenende. Die Plätze seien landesweit so gut wie ausgebucht, sagte der Verbandsvorsitzende Leo Ingenlath. Auch für die Sommerferien gebe es schon ungewöhnlich viele Buchungen, etwa für zweiwöchige Aufenthalte.
Wie wird Home-Office nach Corona aussehen?
Die Produktivität sowie die Vor- und Nachteile von Home-Office gegenüber der Arbeit im Büro wurden bereits vor der Corona-Krise von Unternehmen und Politik diskutiert. Studien und die Praxis zeigen, dass Arbeitnehmer durchaus selbst in der Lage sind, einzuschätzen, ob sie durch die Möglichkeit des Home-Office produktiver werden.

Juniorprofessorin Dr. Elena Shvartsman von der WHU - Otto Beisheim School of Management fasst diese Erkenntnisse zusammen und stellt Überlegungen zu den Auswirkungen des Home-Office und zur Gestaltung des Arbeitens nach Corona an. Laut Shvartsman sollten Unternehmen bei ihren Entscheidungen auch den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter Gehör schenken.
Das Recht auf Home-Office hat schon vor längerer Zeit den Weg in die öffentliche Debatte gefunden, doch die Corona-Krise hat diese Arbeitsform ins Rampenlicht und in den Alltag vieler deutscher Arbeitnehmer und Firmen gebracht. Dabei prägten die Nachteile dieses Arbeitsformats bis zuletzt die Vorstellung vieler Chefs: Wie koordiniere ich ein Team, wenn die Leute gar nicht da sind? Dient Home-Office nicht als Ausrede, um einen lockeren Tag zu Hause zu verbringen? Daher ist es nicht verwunderlich, dass laut zweier führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute viel Home-Office Potenzial ungenutzt bleibt. Es gibt aber auch Argumente, die für das Home-Office sprechen. So schätzen viele Arbeitnehmer den ruhigeren Arbeitsplatz zu Hause ohne die Ablenkungen des Büros oder die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie aufgrund größerer zeitlicher Flexibilität und den Wegfall des Pendelns. Darüber hinaus gibt es auch direkte Vorteile aus der Sicht des Arbeitgebers, wie zum Beispiel Einsparung bei Büromieten aufgrund des geringeren Bedarfs an physischen Räumlichkeiten.
Die Corona-Krise hat nun viele Unternehmen dazu gezwungen, Home-Office im Schnelldurchlauf einzuführen. Wie zu erwarten, hat dies zu gewissen Abstimmungsproblemen geführt, da nicht immer genügend Zeit zur Verfügung stand, um das eigene Heim für das perfekte Home-Office aufzurüsten - sei es technisch oder räumlich. Die derzeitige Ausnahmesituation lässt sich auch nur schwer als Maßstab für die Beurteilung der Auswirkungen von Home-Office auf Produktivität oder die Mitarbeitermotivation heranziehen. Dennoch dürften viele Unternehmen bereits erkannt haben, dass die meisten Koordinationsprobleme mithilfe digitaler Tools überwunden werden können. Schon vor einiger Zeit konnten Wissenschaftler mittels einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung sogar zeigen, dass Mitarbeiter durch die räumliche Trennung und die damit einhergehende erhöhte Eigenverantwortung eine größere Motivation und Eigeninitiative an den Tag legen.
Aus Sicht der Arbeitnehmer gestaltet sich die Lage komplexer. Die Evaluation dieser neuen Arbeitserfahrung wird wohl vor allem entlang der Kinderbetreuungslinie verlaufen. Zurzeit finden sich in den sozialen Medien viele Referenzen zu den großen Fortschritten, die die Menschheit in Zeiten der Isolation gemacht hat. Zum Beispiel soll Newton während der pestbedingten Schließung von Cambridge im Jahre 1665 unter anderem die Gravität entdeckt haben. Dieser Erwartungshaltung der Selbstoptimierung durch die Entschleunigung und Ruhe halten andere entgegen, dass solche Arbeitsbedingungen nur jenen nützen, die keine Kinder betreuen müssten. Ein weiterer und durchaus relevanter Punkt, der insbesondere für diejenigen gilt, die allein und vermutlich in Ruhe zu Hause arbeiten können, ist die soziale Isolation. Ein vielzitiertes, großräumig angelegtes, Experiment in einem chinesischen Reiseunternehmen gibt darüber Aufschluss. Zu Beginn des Experiments wurde mittels Los entschieden, welche Mitarbeiter für mehrere Monate an vier Werktagen pro Woche ins Home-Office dürfen und wer weiterhin wie gewohnt im Büro arbeitet. Die Befunde dieser Studie zeigen, dass trotz durchschnittlich größerer Produktivität im Home-Office viele Mitarbeiter am Ende des Experiments die Rückkehr ins Büro wünschten. Viele gaben an, dass sie den Austausch mit Kollegen vermissten. Mehr noch: Trotz der eben durchschnittlich besseren Leistungen, wurden jene, die im Home-Office arbeiteten, seltener befördert. Hier vermuten die Forscher, dass dies vor allem der schlechteren Sichtbarkeit der Arbeitnehmer gegenüber den sich im Büro befindenden Vorgesetzten geschuldet war.
Dennoch kann dieses Experiment aber durchaus richtungsweisend für unsere Erwartungen im Hinblick auf die Entwicklung des Home-Office nach Corona sein. Am Ende des Experiments durften alle Mitarbeiter - vorausgesetzt, sie verfügten über das nötige Equipment und die räumlichen Möglichkeiten - selbst entscheiden, ob sie überwiegend im Büro oder von zu Hause arbeiten möchten. Überraschenderweise führte dies zu viel größeren Produktivitätszuwächsen als während der zufälligen Zuteilung während des Experiments, da sich jene für das Home-Office entschieden, deren Leistung in der Heimarbeit auch besser ausfiel.
(Text: WHU - Otto Beisheim School of Management)
Warum trifft die Corona-Krise Beitragszahler stärker als Rentner?
Warum trifft die Corona-Krise die Beitragszahler stärker als die Rentner - profitieren Rentner gar finanziell von der Krise? Auf Grund mehrerer Faktoren sind Rentner finanziell weniger stark von der Corona-Krise betroffen als die Erwerbstätigen. Paradoxerweise werden Rentner sogar durch die Effekte der Krise langfristig bessergestellt. Dies hat unterschiedliche Gründe, die erläutert werden.

Rentenanpassungen treten immer ein bis zwei Jahre zeitversetzt ein. Deshalb werden Rentner im Corona-Jahr 2020 eine Rentenerhöhung erhalten, die durch die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre bedingt ist. Die Renten steigen also zum 1. Juli 2020 um 3,45 Prozent (Westdeutschland) bzw. um 4,20 Prozent (neue Bundesländer) (1). Krisenbedingte Lohnverluste der Beitragszahler treten hingegen unmittelbar ein: So stieg die Zahl der Arbeitslosen, sowie die der Kurzarbeiter im März/April 2020 historisch stark an. In diesen Monaten wurde laut der Bundesagentur für Arbeit für 10,1 Millionen Menschen in Deutschland Kurzarbeit angezeigt – ein Rekordwert. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im April 2020 um 308.000 Menschen im Vergleich zum Vormonat; dies sind 415.000 Menschen mehr im Vergleich zum April 2019 (2). Die Bundesagentur für Arbeit kommt zu der Einschätzung, die “(…) Corona-Pandemie dürfte in Deutschland zur schwersten Rezession in der Nachkriegsgeschichte führen.“ (3)
Durch das Sinken der Lohneinkünfte aufgrund der unmittelbaren Effekte der Krise auf den Arbeitsmarkt wird das Sicherungsniveau der Renten deutlich ansteigen, je stärker die Rezession ausfallen wird. Das bedeutet, dass sich das prozentuale Verhältnis von Lohn (Durchschnittsentgelt) zu (Standard)Rente in Richtung 50 Prozent oder sogar darüber bewegen wird (Vgl.: MEA Discussion Paper 11-2020, Abb. 6, S.12). Grundsätzlich ist dieser Effekt in der Rentenversicherung bekannt und nur insofern problematisch, als steigende Renten bei stagnierenden oder gar fallenden Löhnen und Gehältern in der Gesellschaft zu Unverständnis führen können. Nichtsdestotrotz sind diese Rentensteigerungen fair in dem Sinne, dass es den Rentnern zusteht, an der positiven Entwicklung der Vorjahre teilzuhaben, wenn auch mit Verspätung und zu einem unglücklichen Augenblick.
Hinzu kommt, dass das Sicherungsniveau sich im weiteren Verlauf der Krise und insbesondere in den Jahren nach der hoffentlich bald überstandenen Krise normalerweise wieder an das Lohnniveau anpassen würde. Die zukünftigen Anpassungen der Renten an die nun krisenbedingt stagnierenden oder gar negativen Lohnentwicklungen würden die Renten eigentlich mit der gleichen Verzögerung stagnieren oder gar fallen lassen. Allerdings gibt es eine 2005 eingeführte Regelung im deutschen Rentenrecht, die ein Absinken des Rentenwertes verhindert: die Rentengarantie. Das bedeutet, dass die Renten zwar stagnieren können und nicht mehr steigen, aber Rentner keine Verluste, wie die Beitragszahler durch gesunkene Lohneinkünfte in den Jahren zuvor, verschmerzen müssen. Die Renten können also nicht sinken, eine oder zwei Nullrunden für die Rentner sind aber durchaus denkbar.
Diese Rentengarantie kam bereits nach der Finanzkrise 2008 zum Tragen und schützte damals die Rentner. Damit aber alle Generationen denselben Beitrag zur Abfederung der Krise leisten, wurde diese Absicherung der Rentner mit dem sogenannten Nachholfaktor in den Folgejahren wieder ausgeglichen. Das heißt, die Rentensteigerungen, gekoppelt an die Lohnentwicklung, fielen durch den Nachholfaktor geringer aus, um das Gleichgewicht zwischen Alt und Jung wiederherzustellen. So leisteten die Rentner einen auf mehrere Jahre verteilten Beitrag zur Bewältigung der Krise und der durch die Krise zunächst positive Effekt auf das Sicherungsniveau wurde langfristig wieder abgebaut.
Zwischenfazit: Rentner werden also im Corona-Jahr eine Rentenerhöhung erhalten und auch in den Folgejahren keine Kürzungen wegen der Krise befürchten müssen. Hohe Rentensteigerungen sind in der absehbaren Zukunft aber unwahrscheinlich.
Hier kommen wir nun zu der Frage, ob die Rentner sogar finanziell von der Krise profitieren:
Nach der Krise ist zu erwarten, dass die Löhne wieder ansteigen werden. Davon werden die Rentner – ebenfalls wieder zeitversetzt um ein bis zwei Jahre – profitieren. Neu ist nun, dass die Bundesregierung mit dem Rentenpakt 2018 und der Einführung der „doppelten Haltelinie“ den Nachholfaktor bis 2025 ausgesetzt hat. Damit werden die Rentner also voll am „Aufschwung“ beteiligt, obwohl sie beim „Abschwung“ keine negativen Einbußen hatten. Der Nachholfaktor wird zwar gemäß geltendem Gesetz nach 2025 wieder eingeführt. Dies ist jedoch zu spät, um die nachzuholende Abmilderung der Rentensteigerungen vor 2025 zu berücksichtigen. Das in diesem Sinne „zu hohe“ Sicherungsniveau bleibt nach überwundener Krise also permanent bestehen.
Daher ist zu erwarten, dass die Rentner weniger an Kaufkraft verlieren als die Beitragszahler. Absolut werden die Rentner also nicht von der Krise profitieren, relativ zu den Arbeitnehmern aber schon.
Durch die bis 2025 gültige doppelte Haltelinie wird übrigens auch der Anstieg des Beitragssatzes (aktuell 18,6%) bei 20% gedeckelt. Infolgedessen muss aber ab 2021 mit höheren Bundesmitteln für die gesetzliche Rentenversicherung gerechnet werden. Außer bei einer relativ milden bzw. kurzen Rezession wird schon 2021 die Haltelinie von 20% erreicht, was ohne die Corona-Krise erst 2025 eingetreten wäre. In der Konsequenz müssen die Bundeszuschüsse um bis zu 5 Milliarden Euro bereits im nächsten Jahr (2021) und bis zu 19 Milliarden Euro im Jahr 2025 erhöht werden.
Diese Steuermittel müssten von allen Steuerzahlern aufgebracht werden, also sowohl von den Rentnern als auch der jüngeren Generation. Wie genau die Gewichte verteilt werden, hängt von der Finanzierung des Bundeshaushalts ab. Der erhöhte Finanzbedarf könnte durch eine Erhöhung der Einkommensteuer, der Verbrauchssteuern oder einer Mischung verschiedener Steuerarten gedeckt werden. Durch die Einkommenssteuer werden nach Einführung der nachgelagerten Besteuerung sowohl Rentner als auch Erwerbstätige erfasst; Rentner allerdings auch langfristig in deutlich geringerem Umfang. Der zweite große Einnahmeblock des Bundeshaushalts ist die Mehrwertsteuer. Auch diese dürfte die ältere Generation weniger belasten als die jüngere, da die Konsumausgaben der jüngeren Generation in der Regel höher sind. Auch in dieser Hinsicht wirkt sich die Krise asymmetrisch, d.h. tendenziell zugunsten der Rentner und zulasten der jüngeren Generation aus.
Quellen: (1) Information der Deutschen Rentenversicherung vom 20.03.2020 (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Me...) (2) Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt kompakt, Bundesagentur für Arbeit, April 2020, S. 6ff. (3) Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Blickpunkt Arbeitsmarkt, Bundesagentur für Arbeit, April 2020.
(Text: Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik)
Erntehelfer weiter gefragt
Der Gesundheits- und Arbeitsschutz für ausländische Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft soll künftig noch besser kontrolliert werden. Das haben die Länder-Agrarminister nach Beratungen mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am gestrigen Freitag (8. Mai) zugesichert. Die zusätzlichen Standards wegen der Corona-Pandemie sollten «dauerhaft implementiert» werden, sagte der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD), nach dem Austausch per Videoschalte: «Weil ich es für wichtig erachte, dass man diesen Menschen vernünftige Rahmenbedingungen bietet.»

Klöckner hatte die für die Kontrolle der Hygiene-, Arbeits- und Unterbringungsvorschriften zuständigen Länder aufgefordert, bis Ende Mai nach Berlin zu berichten, «wie vor Ort der Vollzug ist». «Am Ende ist es so: Wenn es schwarze Schafe gibt, dann schadet es allen.» Es müsse unbedingt vermieden werden, dass keine Saisonarbeitskräfte mehr nach Deutschland kommen dürften: «Denn dann hätten wir ein Problem.» Die Bundesregierung hatte Anfang April wegen drohender Engpässe in der Landwirtschaft die Einreise von bis zu 80 000 ausländischen Saisonkräfte in den Monaten April und Mai erlaubt.
«Wir werden auch noch weiterhin Arbeitskräfte brauchen aus dem Ausland», sagte Klöckner. «Die Lage ist dynamisch.» Wichtig sei neben der Unterbringung in geräumigen Unterkünften auch die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen: «Damit steht und fällt die Akzeptanz in der Bevölkerung». Von Bedeutung für die Ankunft neuer Erntehelfer werde die künftige Lage an den Grenzen sein: «Es ist schwieriger, mit dem Flugzeug zu kommen, als sich ins Auto oder den Bus zu setzen.»
Bis spätestens Ende des Jahres wollen die Länder Uneinigkeiten über die künftige Verteilung von EU-Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raumes beilegen. Jost sagte, der «historisch gewachsene Verteilungsmechanismus», der seit 20 Jahren vor allem die neuen Bundesländer bevorzuge, müsse geändert werden. «Es geht um Milliarden und es geht auch um den Besitzstand», sagte er. Die Bereitschaft einiger Bundesländer, «jetzt viel zurückzugeben in andere Länder, die bisher nicht so viel bekommen haben», sei «nur begrenzt ausgeprägt».
Wegen absehbarer Verzögerungen bei der Festlegung des Mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) müsse sich die Landwirtschaft darauf einrichten, dass die neue Agrarförderung seitens der EU nicht vor Anfang 2023 anlaufen werde. Klöckner sagte, auch konkrete Vorschläge für den von der EU-Kommission gewollten «Green Deal» und dessen Auswirkungen auf den Agrarsektor müssten noch abgewartet werden. Es dürfe kein Dumping bei Umweltstandards geben: «Wir verlangen, dass es verbindliche Mindeststandards in der gesamten EU gibt.»
Klöckner sagte, die Coronakrise habe gezeigt, dass es in der Bevölkerung einen Wunsch nach regional hergestellten Lebensmitteln gebe. Dies sei eine Chance: «Ich hoffe, dass diese Wertschätzung auch nach der Coronakrise bestehen bleibt.» Auf den Märkten herrsche große Unsicherheit, sagte Jost. Er hoffe, dass die Wiedereröffnung von Gaststätten zu weiterer Nachfrage und zu einer dauerhaften Wertschätzung der Produkte führen werde.
In der Corona-Krise fand die Konferenz in abgespeckter Form statt. Die Länder hatten sich darauf geeinigt, keine länderspezifischen Themen zu beraten.
(Text: dpa)
Gefahr für Mitarbeiter und hohe Schäden durch Plagiate
Deutschlands Maschinenbauer beklagen wachsende Schäden durch Produkt- und Markenpiraterie. Nach Angaben des Branchenverbandes VDMA liegt das Volumen inzwischen bei geschätzt 7,6 Milliarden Euro jährlich – vor zwei Jahren waren es noch 7,3 Milliarden Euro. Ein Umsatz in dieser Höhe würde im Maschinenbau umgerechnet knapp 35 000 Arbeitsplätze bedeuten, erläuterte der VDMA am Mittwoch (6. Mai) in Frankfurt.

«Erschreckend dabei ist, dass 57 Prozent der Unternehmen von Fälschungen berichten, die eine Gefahr für die Anlage darstellen», sagte VDMA-Experte Steffen Zimmermann laut Mitteilung. «Der Betrieb von gefälschten Maschinen oder Anlagen mit gefälschten Komponenten kann eine echte Gefahr für den Bediener bedeuten.»
Der VDMA mahnte, die Unternehmen sollte darauf achten, dass sich keine Fälschungen einschlichen. Auch weil Ausfälle der Anlage oder Reklamationen von Kunden Folgekosten und Imageschäden verursachen könnten.
Besonders stark blüht der Handel mit gefälschten Maschinen und Komponenten in China. Die befragten Unternehmen nannten die Volksrepublik erneut als wichtigstes Vertriebsland für Plagiate (61 Prozent), gefolgt von Deutschland mit 19 Prozent. Auf dem dritten Platz rangiert erstmals Russland mit 12 Prozent.
Die meisten Fälschungen stammten in der Vergangenheit aus China. Seit der ersten Umfrage 2003 lag die Volksrepublik an der Spitze. In diesem Jahr wurde nicht nach den Herstellungsländern gefragt.
Der VDMA befragt alle zwei Jahre seine Mitgliedsfirmen zum Thema Fälschungen. Aktuell gaben 74 Prozent (2018: 71 Prozent) der befragten Unternehmen an, von Produktpiraterie betroffen zu sein. Bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern waren es sogar 90 Prozent. Beides sind den Angaben zufolge Höchstwerte.
Als Auftraggeber für Plagiate nannten die meisten Maschinenbauer Wettbewerber (72 Prozent). Aber auch Geschäftspartner wie Kunden, Zulieferer oder Joint-Venture-Partner (41 Prozent) sind aktiv. Am häufigsten werden demnach einzelne Teile gefälscht (64 Prozent), gefolgt von Designplagiaten (60 Prozent), aber auch vor ganzen Maschinen (40 Prozent) schrecken Produktpiraten nicht zurück.
Befragt wurden 146 Mitgliedsfirmen (2018: 136) von Anfang Februar bis Anfang März und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa.
(Text: dpa)
BMW erwartet Verlust und baut Arbeitsplätze ab
Der Autobauer BMW rutscht ebenso wie Volkswagen und Daimler in die roten Zahlen. «Das zweite Quartal wird negativ sein», sagte BMW-Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch (6. Mai) in München. Wie hoch der Verlust ausfalle, «werden wir sehen».

Im April seien die Verkaufszahlen um 44 Prozent eingebrochen, sagte Vorstandschef Oliver Zipse. Der Weg aus der Corona-Krise werde länger dauern als gedacht. Die Lage sei extrem volatil und ändere sich dauernd. Das wirtschaftliche Umfeld dürfte sich erst zwischen Juli und September wieder zu stabilisieren beginnen. Der Absatz und der Jahresgewinn vor Steuern «werden deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen», sagte Zipse. «Die Situation bleibt ernst.»
Um die Zahlungsfähigkeit zu sichern, kürzt BMW die Investitionen um ein Drittel auf unter 4 Milliarden Euro und baut Arbeitsplätze ab. Derzeit beschäftigt BMW in Deutschland 90 000 Mitarbeiter, 30 000 von ihnen sind derzeit in Kurzarbeit. Zipse erklärte, jedes Jahr verließen etwa 5000 Mitarbeiter das Unternehmen, die Hälfte von ihnen gehe in Rente.
Ob Stellen nachbesetzt werden, werde jetzt in jedem Einzelfall sehr kritisch geprüft. Außerdem beschäftige BMW bislang mehr Zeitarbeiter als andere Autobauer, auch das werde flexibel genutzt. Der Start des geplanten BMW-Werks in Ungarn werde um mindestens ein Jahr verschoben, und auch sonst komme jede Investition und jedes Projekt auf den Prüfstand.
In China gebe es im April zwar erste Erholungszeichen - aber das sei nur bedingt eine Blaupause für andere Märkte, betonte Zipse. Man müsse kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Nachfrage in Großbritannien, Italien und Spanien dieses Jahr gering bleiben werde. Zwischen null und 3 Prozent vom Umsatz dürften bei BMW dieses Jahr als Betriebsgewinn aus dem Verkauf von Autos hängen bleiben.
Zugleich erwartet BMW ein niedrigeres Ergebnis im Kredit- und Leasinggeschäft. Schon im ersten Quartal wurden weniger Neuverträge abgeschlossen. Die Risikovorsorge für Kredite und den Restwert zurückkommender Leasingautos musste erhöht werden. Das mit Daimler zusammen betriebene Carsharing- und Taxigeschäft «Your Now» leide sehr stark unter der Krise, sagte Zipse.
Im ersten Quartal kam BMW noch mit einem blauen Auge davon. Der Autoabsatz fiel zwar um 21 Prozent auf 477 000 Fahrzeuge, aber unter dem Strich fuhren die Münchener 574 Millionen Euro Gewinn ein - mehr als VW und Daimler zusammen und fast genauso viel wie im Vorjahr. Allerdings war das Vorjahr bei BMW wegen einer Rückstellung von 1,4 Milliarden Euro für eine mögliche Kartellstrafe schwach gewesen.
Die Werke in China und den USA sind inzwischen wieder angelaufen, das größte europäische Werk Dingolfing in Bayern soll ab nächstem Montag langsam wieder anfangen. München, Regensburg, Leipzig und Oxford folgen «frühestens am 18. Mai», sagte Zipse. Wann wieder im Zwei-Schicht-Betrieb Autos gebaut werden, hänge von der Nachfrage ab. «Wir werden jedenfalls nicht übereilt handeln», betonte der BMW-Chef.
Eine Kaufprämie in Deutschland könnte helfen, die Konjunktur insgesamt anzuschieben, sagte Zipse. Sie müsste auch für saubere Verbrenner bezahlt werden, denn «der Effekt entsteht durch das Hochlaufen der Stückzahlen». Das Spitzentreffen der Autobranche mit Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag sei sehr umfassend und konstruktiv gewesen, die Entscheidung sei auf Juni vertagt.
Die CO2-Vorgaben der EU sind aus Sicht von BMW nicht anzutasten: «Wir stehen fest zur Erfüllung der Klimaschutzziele», betonte Zipse. «Forderungen nach Moratorien, sprich einer Verschiebung der Fristen, treten wir entscheiden entgegen.» BMW habe seine Hausaufgaben gemacht und werde in drei Jahren 25 Elektro- und Plug-in-Modelle auf der Straße haben.
Nach der Hauptversammlung nächste Woche will BMW den Aktionären die versprochene Dividende wie geplant auszahlen, ebenso wie die daran gekoppelte Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter. Die Corona-Krise werde sich dann in der Dividende 2021 widerspiegeln, sagte Zipse.
(Text: dpa)
Corona-Krise verschärft Lage auf Ausbildungsmarkt
Die Corona-Krise beschleunigt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) den Rückgang der Ausbildungsplätze in Deutschland. Derzeit gebe es ein Minus bei den angebotenen Lehrstellen von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, sagte die CDU-Politikerin am gestrigen Mittwoch (6. Mai) in Berlin. Allerdings könne es laut Bundesagentur für Arbeit auch noch zu einem Aufholprozess im August und September kommen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser abschätzbar seien. Wirtschaft, Gewerkschaften und Opposition erneuerten am Mittwoch Forderungen nach staatlichen Hilfen, um ein weiteres Wegbrechen von Ausbildungsplätzen zu verhindern.

SCHON VOR CORONA PROBLEME: Dass es auf dem Lehrstellenmarkt auch ohne Corona schon Probleme gab, zeigt der jährliche Berufsbildungsbericht, der am Mittwoch Thema im Bundeskabinett war und anschließend veröffentlicht wurde. Der Bericht gibt Auskunft über die Situation auf dem Lehrstellenmarkt im vergangenen Jahr. Demnach boten die Betriebe 2019 rund 11 000 Ausbildungsstellen weniger an als 2018. Das Angebot lag bei knapp 578 000. Gleichzeitig sank aber auch die Zahl der Bewerber von 556 000 auf knapp 550 000. Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge ging um 6 300 auf 525 100 zurück. Rechnerisch bestand damit zwar weiterhin ein Überangebot, aber sinkende Azubizahlen bedeuten auch sinkenden Fachkräftenachwuchs.
«Der Rückgang ist im Wesentlichen auf das Handwerk sowie Industrie und Handel zurückzuführen», heißt es in dem Bericht. Das Bildungsministerium wies zudem auf den demografischen Wandel und eine geringere Zahl an Absolventen von allgemeinbildenden Schulen hin.
BONUS FÜR AUSBILDUNGSBETRIEBE: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte am Mittwoch vor einem «Corona-Crash» auf dem Ausbildungsmarkt und forderte einen Bonus für Unternehmen, die Azubis aus insolventen Betrieben übernehmen. Forderungen nach finanzieller Unterstützung kamen auch aus der IG Metall und von Wirtschaftsverbänden. Der Bund könne bei weiter angespannter wirtschaftlicher Lage denjenigen Betrieben einen finanziellen Bonus gewähren, die für das kommende Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Auch die Linke schloss sich der Bonus-Forderung an. «Es wird deutlich, dass die Corona-Krise auf bereits lang bestehende massive Probleme des Ausbildungsmarktes trifft und hier wie ein Brandbeschleuniger zu wirken droht», sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Birke Bull-Bischoff.
Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, verwies am Mittwoch auf eine Umfrage unter Handwerksbetrieben, wonach sich jeder vierte Betrieb im kommenden Ausbildungsjahr aus der Ausbildung zurückziehen wolle. Wollseifer forderte deshalb eine finanzielle Unterstützung von Klein- und Kleinstbetrieben. «Denn 83 Prozent der Ausbildungsbetriebe in Deutschland zählen zu dieser Betriebsgröße.»
UNTERNEHMEN IN «WARTESCHLEIFE»: Nach Angaben des Präsidenten des Bundesinstituts für Berufsbildung, Friedrich Hubert Esser, sind die Unternehmen beim Thema Ausbildung momentan «in einer Art Warteschleife». Sie hofften auf ein Wiederanlaufen der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte und darauf, dass dann der Fachkräftebedarf in den Unternehmen wieder virulent werde, sagte er.
Der für berufliche Bildung zuständige Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Jens Brandenburg, nannte die sinkende Ausbildungsquote «erschreckend». «Fehlende Ausbildungsplätze sind der Fachkräftemangel von morgen.» Es müsse alles dafür getan werden, dass Corona nicht zur Ausbildungskrise werde. Der CDU-Bildungspolitiker Stefan Kaufmann sagte: «Für die berufliche Bildung gilt ebenso wie für das Krisenmanagement insgesamt: überlegtes Handeln, keine Schnellschüsse sind gefragt.» Die aktuelle Ausnahmesituation könne für die berufliche Bildung mit Blick auf das Thema Digitalisierung auch eine Chance sein.
Über konkrete Maßnahmen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen wollen Bund, Länder, Gewerkschaften und Unternehmerverbände Ende Mai beraten. Das hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigt.
KARLICZEK: «TOLLE STARTCHANCEN» MIT BERUFSAUSBILDUNG. Bildungsministerin Anja Karliczek machte am Mittwoch noch einmal Werbung für die Berufsausbildung: «Liebe Jugendliche, (...) denken Sie nicht immer nur an ein Studium. Mit einer Ausbildung haben Sie exzellente Berufsaussichten.
SCHEELE: Keinen «Jahrgang Corona» erlauben. Die Bundesagentur für Arbeit hat die Unternehmen aufgerufen, die Ausbildung nicht zu vernachlässigen. «Wir wissen, dass Betriebe in der aktuellen Situation unsicher sind und vielleicht die Besetzung von Ausbildungsstellen für dieses Jahr zumindest zurückstellen», sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, in Nürnberg.
Es zahle sich für die betriebliche Zukunft aus, wenn Unternehmen jetzt trotz der aktuellen Lage in Ausbildung investierten. «Es darf 2020 keinen "Jahrgang Corona" geben», sagte Scheele. Das wäre sowohl arbeitsmarktpolitisch ein Fehler als auch für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger fatal.
(Text: Jörg Ratzsch, dpa)
Gerry Weber streicht wegen Corona-Krise 200 weitere Arbeitsplätze
Der angeschlagene Mode-Hersteller Gerry Weber wird wegen der durch die Corona-Krise verursachten Absatzprobleme mehr als 200 weitere der zuletzt noch rund 3000 Arbeitsplätze abbauen. «Leider ist der Schritt unabdingbar, wenn wir die verbleibenden Arbeitsplätze erhalten wollen», sagte Gerry Weber-Chef Alexander Gedat. Die vorübergehende Schließung nahezu aller Verkaufsflächen des Unternehmens im Zuge der Corona-Pandemie habe bei Gerry Weber zu einem Umsatzausfall von deutlich mehr als 100 Millionen Euro geführt, berichtete das Unternehmen.

Der seit langem mit wirtschaftlichen Problemen kämpfende Modehersteller hatte erst zum Jahreswechsel das im April vergangenen Jahres eröffnete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung hinter sich gelassen. Im Zuge der Sanierungsbemühungen waren nicht nur mehr als hundert Filialen geschlossen sondern auch bereits rund 1000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Doch reichten die damals eingeleiteten Maßnahmen angesichts der Corona-Pandemie offenbar nicht aus.
Das Unternehmen habe deshalb in den vergangenen Wochen mit Hochdruck ein neues Zukunftskonzept erarbeitet. «Im Kontext aller Maßnahmen, die wir aktuell ergreifen, um Gerry Weber zu retten, ist die erneute Reduzierung der Belegschaft die mit Abstand bitterste, und es fällt uns unglaublich schwer, diesen Schritt zu gehen», betonte Gedat. Doch verlange das Konzept auch von allen anderen Beteiligten schmerzhafte Beiträge zur Bewältigung der Krise.
So seien mit Geschäftspartnern und Lieferanten Verträge neuverhandelt worden, mit dem Ziel, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Darüber hinaus hätten die Eigentümer von Gerry Weber, die Finanzinvestoren Robus, Whitebox und J.P. Morgan, zugesagt, erhebliche finanzielle Beiträge zur Sicherstellung des Betriebs zu leisten. Ein Großteil der Insolvenzgläubiger soll außerdem einen Teil seiner Forderungen stunden. Der Konzern hofft, mit dem neuen Zukunftskonzept seine Restrukturierung erfolgreich fortsetzen zu können.
(Text: dpa)