Pflegekräfte sollen wegen Corona-Krise 1500 Euro Prämie bekommen
Wegen der Zusatzbelastungen in der Corona-Krise sollen Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege mit dem Juli-Gehalt eine Prämie von 1500 Euro bekommen. Für Azubis ist eine Extra-Zahlung von 900 Euro geplant. Teilzeitbeschäftigte sollen eine Prämie entsprechend ihrer tatsächlich geleisteten Stunden erhalten. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) laut einer Mitteilung geeinigt. Festgehalten werden solle die Regelung in einem eigenen Tarifvertrag.

Der BVAP vertritt nach eigenen Angaben mehrere hundert Unternehmen und Verbände, die als Pflegeanbieter auftreten, wie den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Arbeiterwohlfahrt (Awo), die Volkssolidarität und den Paritätischen Gesamtverband. Man werde beantragen, dass der Tarifvertrag für die Mitarbeiter dort für allgemeinverbindlich für die ganze Branche erklärt wird, so dass alle Arbeitgeber in der Pflege diese Prämie zahlen müssten, sagte Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand.
Das Bundesarbeitsministerium kann einen Tarifvertrag im Einvernehmen mit Vertretern der Spitzenorganisationen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für allgemeinverbindlich erklären. Sollte das Vorhaben erfolgreich sein, könnten nach Angaben eines Verdi-Sprechers von der Prämie mehr als eine halbe Million Beschäftigte in der Pflege profitieren. «Die Corona-Pandemie führt allen vor Augen, wie wichtig die Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen ist», sagte Bühler. BVAP-Vorstandsmitglied Gero Kettler sagte, die Prämie sei eine Anerkennung der besonderen Belastung in der Krise.
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rief andere Arbeitgeber in der Pflege auf, dem Beispiel zu folgen. «Dies sollte Vorbild für alle Arbeitgeber in der Pflegebranche sein, damit die Leistung aller Pflegenden eine gerechte Wertschätzung erhält», sagte Heil am Montag (6. März). «Der Einsatz der Pflegekräfte verdient unsere größte Anerkennung, gerade in diesen Zeiten». Die Prämie sei steuer- und sozialabgabenfrei.
In den vergangenen Tagen war verstärkt über mögliche Sonderzahlungen für Personal aus Medizin und Pflege diskutiert worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte in der «Bild am Sonntag» angekündigt, allen Pflegekräften in Bayern eine steuerfreie Bonuszahlung von 500 Euro zukommen zu lassen.
(Text: dpa)
Elektrohandwerke und die Corona-Krise
Rund 2.000 E-Innungsfachbetriebe haben sich in nur drei Tagen an einer Sonderumfrage beteiligt, die der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke am vergangenen Montag (30.3.) gestartet hatte, um ein Bild davon zu erhalten, wie stark die Elektrohandwerke von der Krise betroffen sind und wo sie diesbezüglich die größten Herausforderungen sehen.

Dabei zeigt die Umfrage: Rund 60 Prozent (58,6 %) der Betriebe verzeichnen infolge der Corona-Pandemie Umsatzrückgänge. Bei 41,4 Prozent hat die Krise diesbezüglich keine oder noch keine Auswirkungen. Das liegt zum einen daran, dass elektrohandwerkliche Betriebe nicht so stark von Schließungen betroffen sind wie andere Gewerke. Zum anderen verfügten, das hatte die Frühjahrsumfrage gezeigt, mehr als die Hälfte der Unternehmen über ein Auftragspolster von bis zu zwei und mehr Monaten.
Durchschnittliche Verluste in Höhe von 44 Prozent: Dort, wo sich die aktuelle Situation bereits auf die Geschäftslage der Unternehmen auswirkt, beläuft sich der durchschnittliche Verlust auf 44 Prozent. Relativ gering ist die Betroffenheit in Bezug auf Erkrankungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So gaben nur 15,1 Prozent der Befragten an, dass sich Personal aufgrund einer Covid-19-Infektion in Quarantäne begeben musste.
Wie reagieren die Betriebe? Auf die aktuelle Situation haben bislang 24,7 Prozent der befragten Unternehmen mit Arbeitszeitverkürzungen oder Ähnlichem reagiert. 75,3 Prozent haben demnach noch keine Mittel zur Arbeitszeitverkürzung angewendet. Verglichen mit der kürzlich durchgeführten Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) ist das ein relativ geringer Prozentsatz. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Elektrohandwerke im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen – wie Gastronomie oder Friseurhandwerk – deutlich weniger von behördlichen Auflagen betroffen sind und Aufträge, wenn auch in geringerem Ausmaß, weiter ausführen können.
Abbau von Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit: Bei denjenigen Betrieben, die bislang auf die veränderte Geschäftssituation reagierten, wählten 66,2 Prozent als Maßnahme den Abbau von Arbeitszeitkonten. 64,5 Prozent ordneten Urlaub für die Belegschaft oder Teile davon an und 52,9 Prozent beantragten Kurzarbeit. Nur 10,3 Prozent dieser Unternehmen mussten Mitarbeitern kündigen und 6,4 Prozent schlossen ihren Betrieb komplett.
Zurückhaltung zeigten die befragten elektrohandwerklichen Betriebe jedoch nicht nur hinsichtlich Arbeitszeitkürzungen. Auch staatliche Hilfen wurden bislang erst von 21,7 Prozent in Anspruch genommen. Bei den staatlichen Hilfen favorisierten die Betriebe staatliche Zuschüsse (57,5 %), gefolgt von Steuerstundungen (41,5 %) und Kurzarbeitergeld (39,8 %). Liquiditätshilfen nahmen lediglich 11,2 Prozent in Anspruch.
Staatliche Hilfen werden positiv gesehen: Befragt nach ihrer Meinung zu Höhe und Komplexität der Hilfen sowie Bearbeitungsdauer für die Beantragung äußerten sich die Umfrageteilnehmer recht differenziert. Positiv wurde gesehen, dass die Antragstellung bei den staatlichen Zuschüssen unkompliziert ist. Allerdings werden diese als zu niedrig bewertet. Kritisiert wird auch die Dauer der Antragsbearbeitung bei den Liquiditätshilfen.
Lieferengpässe am ehesten im Bereich „Licht“: Um herauszufinden, ob es bereits Probleme gibt, an bestimmte Produkte heranzukommen, hatte der ZVEH in seiner Umfrage auch nach Lieferengpässen gefragt. Dabei zeigte sich: 30,7 Prozent der Befragten haben Probleme, Produkte aus der Elektroindustrie zu beziehen. Am stärksten betroffen sind Produkte aus dem Bereich „Licht und Beleuchtung“ (51,3 %), gefolgt von Gebäudeautomation (25,0 %) sowie Erneuerbare Energien und Elektrogeräte (beide 19,3 %). Zahlreiche Betriebe gaben an, dass Produkte aus China und Italien aufgrund der Corona-Krise nicht geliefert werden konnten. Preislich registrierten die Betriebe indes kaum Veränderungen. Über alle Produktbereiche hinweg blieben die Preise nahezu unverändert. Veränderungen gab es am ehesten bei Produkten aus den Bereichen „Licht und Beleuchtung“ und „Erneuerbare Energien“.
Blick auf die nächsten Monate: Auch wenn sich die eingangs angeführten Zahlen angesichts einer sich weiter verschärfenden Krise noch halbwegs passabel ausnehmen: Dass sich die Situation auch in den Elektrohandwerken erheblich verändert hat, zeigt sich am Einbruch des Geschäftsklimaindex. Hatte dieser bei der nur vier Wochen zuvor durchgeführten Frühjahrskonjunkturumfrage noch bei erfreulichen 88,2 Punkten gelegen, so sank er nun auf 55,6 Punkte ab. Während in der Vor-Corona-Befragung noch 78,8 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als „gut“ bezeichnet hatten, waren es nun lediglich 30,1 Prozent.
Was den Blick in die Zukunft betrifft, zeigen sich die Innungsbetriebe nun ebenfalls deutlich pessimistischer – dies auch bedingt durch die Tatsache, dass die weitere Entwicklung der Krise – wie auch die Dauer der Einschränkungen – momentan kaum absehbar ist. Davon, dass sich die Geschäftssituation „verschlechtert“ oder „deutlich verschlechtert“, gehen jetzt 54,8 Prozent aus (Frühjahrumfrage: 7,8 %). Davon, dass diese gleichbleibt, 23,7 Prozent (Frühjahrsumfrage: 64,1 %). Eine Verbesserung erwarten lediglich 3,2 Prozent – gegenüber 28,1 Prozent der Frühjahrsumfrage.
Preise und Neueinstellungen: Ein Faktor, der die Beurteilung beeinflusst haben dürfte, ist, dass die Auftragspolster abschmelzen und dass aktuell keine Aussagen dazu getroffen werden können, wann der Shutdown beendet ist und wieder mit einem Hochfahren der Wirtschaft begonnen werden kann. Hatten im Februar 2020 noch 65,7 Prozent der Betriebe angegeben, offene Stellen zu haben, sind es jetzt nur noch 31,7 Prozent. Das bedeutet: Neueinstellungen werden erst einmal zurückgestellt. Mit einer Erhöhung ihrer Verrechnungspreise auf die Krise zu reagieren, planen indes nur 17,5 Prozent der Umfrageteilnehmer. Der Löwenanteil (76,4 %) will seine Preise nicht erhöhen.
Eine Veränderung zeigt sich dagegen hinsichtlich des Umgangs mit staatlichen Unterstützungsleistungen. In den nächsten Wochen werden, so ein Ergebnis der Umfrage, deutlich mehr Betriebe staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. So wollen 53,9 Prozent der Unternehmen solche Instrumente nutzen und setzen dabei vor allem auf Kurzarbeitergeld und staatliche Zuschüsse.
„Die Ergebnisse unserer Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Elektrohandwerke zeigen, dass unsere Mitglieder bislang noch etwas weniger stark betroffen sind als andere Gewerke. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass die Geschäftssituation vor Ausbruch der Pandemie überwiegend gut war und dass viele Betriebe über Auftragspolster verfügten. Klar ist aber auch: Die Wirtschaftslage trübt sich auch in den Elektrohandwerken mit hoher Geschwindigkeit ein. Die Zahl derer, die staatliche Unterstützung beantragen werden, steigt. Und je länger diese Situation andauert, desto größer werden die Umsatzeinbrüche sein“, so ZVEH-Hauptgeschäftsführer Ingolf Jakobi: „Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, ist es nun ganz wichtig, rechtzeitig über Exit-Strategien zu sprechen und Pläne zu entwickeln, wie sich die Wirtschaft nach Beendigung des Shutdowns ohne größere Verzögerungen wieder ankurbeln lässt.“
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Situation wird der ZVEH seine Befragung im weiteren Verlauf der Corona-Krise wiederholen. Die Ergebnisse will der Verband für die politische Kommunikation sowie dafür nutzen, seine Mitglieder noch besser bei der Krisenbewältigung zu unterstützen.
(Text: Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH))
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für Glas-Beschäftigte
Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und der Bundesarbeitgeberverband Glas und Solar (BAGV GLAS + SOLAR) haben sich auf eine Vereinbarung zur Bewältigung der Corona-Pandemie geeinigt. Damit wollen die Sozialpartner Arbeitsplätze und Unternehmen in der Glasbranche schützen.
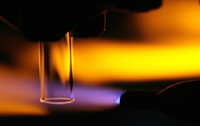
Zum ersten Mal haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber eine tarifliche Bundesregelung für die 50.000 Beschäftigten getroffen. Das war bisher wegen der Abwehrhaltung der Arbeitgeber nicht möglich. Es gab nur regionale und firmenbezogene Regelungen. Der stellvertretende IG-BCE-Vorsitzende und Tarifvorstand Ralf Sikorski sagt: „Wir erleben gerade eine der größten Herausforderungen für die Menschen, für die Gesundheitssysteme und für die Wirtschaft seit dem zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung der Pandemie zwingt uns, schnell und effektiv zu handeln um die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.“
Das habe letztendlich wohl auch die Arbeitgeber dazu bewegt, sich auf die Vereinbarung einzulassen. „Diese Einigung ist ein großer Erfolg für uns, die Verhandlungen waren ein zähes Ringen“, berichtet Sikorski. „Einige Arbeitgeber im Arbeitgeberverband haben zunächst sehr lange gemauert und wir brauchten extrem viel Durchhaltevermögen.“ Am Ende waren nur wenige kleine Unternehmen nicht bereit sich dieser Tarifvereinbarung anzuschließen.
Knackpunkt bei den Verhandlungen war die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld: Das Kurzarbeitergeld wird mit der Vereinbarung auf 80 Prozent des bisherigen Nettoentgelts erhöht. Für Betriebe, die jetzt schon eine andere Aufstockungsregelung haben, gilt diese aber weiterhin.
Die Sozialpartner haben sich zudem darauf verständigt, die Ankündigungsfrist bei Kurzarbeit auf drei Tage zu verkürzen. Außerdem vereinfacht wurde die Regelung zum mobilen Arbeiten. Um während der Pandemie die Beschäftigten weitgehend vor Infektionen am Arbeitsplatz zu schützen, kann der Arbeitgeber auf Basis einer freiwilligen Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten anordnen, sofern alle sonstigen Voraussetzungen gegeben sind.
Ebenfalls um Infektionsrisiken durch Kontakte im Betrieb und durch Arbeitswege zu reduzieren, kann zeitlich befristet ein Zwölf-Stunden-Schichtsystem im kontinuierlichen Schichtbetrieb eingeführt und die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden erhöht werden. Zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen können tarifgebundene Unternehmen der Glas- und Solarbranche untereinander Arbeitnehmer überlassen.
Gleichzeitig haben sich die IG BCE und der BAGV GLAS+SOLAR auf eine gemeinsame Erklärung zur Bedeutung der Produktion und der Produkte der Glasindustrie gerade in Zeiten der Pandemie geeinigt (siehe Anhang). Der technische Prozess der Glaserzeugung birgt große Herausforderungen: Schon kurze Betriebsschließungen würden in vielen Fällen das Ende des Betriebes bedeuten. Denn aus technischen Gründen können Glaswannen nach einer Stilllegung nicht wieder in Betrieb genommen werden. Und der Aufbau einer Glaswanne ist eine lang geplante Millioneninvestition.
Die Sozialpartner der Glasbranche fordern deshalb Ausnahmeregelungen zum Erhalt der Glaswannen im Falle von behördlichen Maßnahmen wie zum Beispiel einer Ausgangssperre. Denn die Unternehmen der Glasbranche sind in den Lieferketten des Gesundheits-, Ernährungs- und Energiesektors unabdingbar für den Erhalt kritischer Dienstleistungen. Sie sind zum Beispiel auch weltweit führend in der Herstellung von Verpackungen für Medizinprodukte und Medikamente.
(Text: IG BCE - Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie)
Deutschland will Erntehelfer unter Corona-Auflagen einfliegen
Angesichts drohender Engpässe in der Landwirtschaft sollen 80 000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland eingeflogen werden. Um beim Ernten und anderen dringenden Feldarbeiten zu helfen, können im April und Mai je 40 000 Menschen kommen. Ergänzend sollen aus dem Inland möglichst jeweils 10 000 Helfer gewonnen werden - etwa Arbeitslose, Studierende, Asylbewerber oder Kurzarbeiter wegen der Corona-Krise. Auf entsprechende Pläne verständigten sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag ( 2. April). Darum war wegen kürzlich verhängter Einreiseverbote an den Grenzen gerungen worden.

Klöckner sprach von einer pragmatischen Lösung, die dem nötigen Infektionsschutz und der Erntesicherung Rechnung trage. Dies sei eine wichtige und gute Nachricht für die Bauern. «Denn die Ernte wartet nicht, auch Aussaaten kann man nicht verschieben.» Seehofer sagte, die strengen Corona-Vorgaben träfen Bevölkerung und Wirtschaft hart, seien aber erforderlich, um die Infektionsketten zu unterbrechen. «Dabei ist es wichtig, Voraussetzungen zu schaffen, damit wir auch während der Pandemie Staat und Wirtschaft am Laufen halten.» Der Bauernverband (DBV), der für rasche Einreise-Erleichterungen geworben hatte, begrüßte die Einigung der Bundesregierung.
Um eine rasche Virus-Ausbreitung in Deutschland zu verhindern, hatte das Innenministerium weitgehende Einreisebeschränkungen für Saisonarbeiter verhängt. Davon waren vor allem Helfer aus Rumänien betroffen. Bis zum Einreisestopp am 25. März waren schon rund 20 000 Saisonarbeiter im Land - sie können nach bereits beschlossenen Änderungen im Arbeitsrecht auch länger hier bleiben. Doch der Bedarf ist höher. Daher wurden nun Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen vereinbart und zahlreiche begleitende Bedingungen festgelegt.
Konkret sollen die Arbeiter in den beiden Kontingenten für April und Mai nur in Gruppen und per Flugzeug einreisen - das soll stundenlange Busfahrten quer durch Europa vermeiden. Die Erntehelfer sollen nach Rückmeldungen der Landwirte ausgewählt werden. Die Bundespolizei legt in Abstimmung mit den Bauernverbänden fest, an welchen deutschen Flughäfen sie landen. Dort sollen sie nicht einzeln weiterfahren, sondern werden durch den Betrieb abgeholt. Bei der Einreise folgt ein Gesundheitscheck, die Ergebnisse bekommt das örtliche Gesundheitsamt.
Menschen, die neu anreisen, müssen dann in den ersten 14 Tagen strikt getrennt von sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten. Sie dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen - die Regierung nennt dies eine «faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit». Es gilt eine zwingende Einteilung in Unterkunfts- und Arbeitsteams, so dass die Saisonkräfte in gleichen, möglichst kleinen Gruppen von fünf bis zehn, maximal 20 Personen arbeiten. Dabei sind auch Mindestabstände einzuhalten. Mit Ausnahme von Familien sollen Zimmer in Unterkünften nur mit halber Kapazität belegt werden können.
Besucher sind auf den Betriebsgeländen verboten. Wäsche und Geschirr müssen bei mindestens 60 Grad gereinigt werden. Gemeinschaftsräume wie Küchen dürfen von einzelnen Arbeitergruppen nie gleichzeitig genutzt werden. Die Einhaltung der Regeln soll von den zuständigen Arbeitsschutzbehörden und vom Zoll kontrolliert werden. Die Regeln gehen auf Leitlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) zurück. Gibt es einen begründeten Verdacht auf Infizierung, ist der Arbeitnehmer zu isolieren, ein Arzt muss ihn und auch das ganze Team testen.
Der innenpolitische Sprecher der Union, Mathias Middelberg (CDU), begrüßte den Kompromiss. «Die strengen Vorgaben zu Hygiene und Unterbringung sorgen für bestmöglichen Infektionsschutz.» Aus Sicht von FDP-Fraktionsvize Frank Sitta bringt die Regelung «eine erste Erleichterung». Es stelle sich aber die Frage, warum trotzdem eine starre Obergrenze vorgegeben werde. Laut Branchenschätzungen sei der Bedarf an erfahrenen Saisonarbeitern aus dem Ausland weit höher - sonst kommen knapp 300 000 Saisonarbeiter im Jahr nach Deutschland.
Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied erklärte, nach der Einigung gehe es jetzt an die Umsetzung. «Unsere Betriebe werden die Leitlinien und Vorgaben des RKI strikt einhalten, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Diese Regelung hilft uns arbeitsfähig zu bleiben.»
Aktuell laufen Pflanzarbeiten unter anderem für Salate, Kohl und viele andere Gemüsearten. Daneben steht die Ernte bei Spargel, Rhabarber, Salaten, Erdbeeren und Salatgurken an.
(Text: Anne-Béatrice Clasmann und Sascha Meyer, dpa)
Lufthansa-Vorstand wirkt konzeptlos und überfordert
Mit großem Unverständnis nimmt die Vereinigung Cockpit die Ankündigung des Lufthansa-Konzernvorstandes zur Kenntnis, das mit dem Management der Germanwings über Tage ausgehandelte Ergebnis zur Kurzarbeit nicht zu akzeptieren. In tagelangen Sitzungen hatten sich jüngst die Vereinigung Cockpit und die Geschäftsleitung der Germanwings, unter Berücksichtigung der firmenspezifischen Konditionen, auf einen Tarifvertrag zur Kurzarbeit geeinigt.

Die Argumentation, die wirtschaftliche Situation der Germanwings gebe das Ergebnis nicht her, ist unglaubwürdig, insbesondere da es sich bei Germanwings um eine hundertprozentige Tochter des Lufthansa-Konzerns handelt. Weder die Mutter noch die Tochter erwirtschaften derzeit nennenswerte Umsätze.
Vor dem Hintergrund, dass aktuell noch ausreichend Liquidität vorhanden ist und zudem der Staat deutlich signalisiert hat, durch die Corona-Krise in Bedrängnis geratene Unternehmen zu stützen, um die Arbeitsplätze zu erhalten, ist es nicht nachvollziehbar, wieso man bereits jetzt Teile des Unternehmens in Frage stellt.
Markus Wahl, Präsident der Vereinigung Cockpit: „Wir halten es für eine unverantwortliche Schädigung des Unternehmens, in der derzeitigen Lage eine Kostensenkung von knapp 50% der Lohnkosten der Piloten an Kurzarbeitsgeldern auszuschlagen. Weder ist absehbar, wie lange die Krise anhalten wird, noch wie es dann weitergehen kann. Der Eindruck drängt sich auf, dass der Konzernvorstand versucht, die „Gunst der Stunde“ zu nutzen, um strukturelle Veränderungen des Konzerns durchzudrücken. Bereits vor der Krise gab es Gespräche über einen Weiterbetrieb der Germanwings, die aber nicht primär durch eine unzureichende Wirtschaftlichkeit, sondern durch die vom Vorstand gewünschte veränderte Aufstellung des Konzerns getrieben waren. Es geht um deutlich über tausend Menschen und deren Familien, die nun zutiefst verunsichert sind. Das ist unverantwortlich, insbesondere da der Konzernvorstand augenscheinlich keinen Plan hat, wie es weitergehen soll. Jetzt ist es an der Zeit, Arbeitsplätze zu sichern und nicht den Konzernumbau zu forcieren. Zum Wohle des Konzerns und der Mitarbeiter fordern wir den Konzernvorstand auf, den Tarifvertrag Kurzarbeit bei Germanwings zu unterschreiben.“
(Text: Vereinigung Cockpit)
Bauern fehlen Saisonarbeiter
Der Spargelbauer Jörg Heuer hat schnell reagiert: Als die Bundesregierung vergangene Woche ankündigte, ausländischen Saisonarbeitern wegen des neuen Coronavirus die Einreise zu verweigern, charterte der 49-Jährige kurzerhand ein eigenes Flugzeug. Für eine fünfstellige Summe, wie er sagt, ließ er rund 120 Rumänen einfliegen, um seine Ernte - und damit sein Geschäft - zu retten.

Auf mehr als 100 Hektar Land baut Heuer bei Burgwedel in Niedersachsen Spargel und Beeren an, in zweiter Generation, die Eltern des 49-Jährigen haben den Hof 1981 gegründet. Mit dem Flieger hat er einen Personalengpass bei der Ernte in diesem Jahr gerade noch abgewendet. «Wir kommen zurecht», sagt er. In der Branche allerdings gebe es dieses Jahr deutlich weniger Erntehelfer als sonst. Auch ihm hätten viele bewährte Helfer diesmal abgesagt.
Spargel ist ein Luxusgemüse, man kann auch ohne ihn gut leben, auch wenn das «weiße Gold» für viele zum Frühling dazugehört wie die Ostereier. Für Heuer aber ist der Spargel die wirtschaftliche Existenzgrundlage. «Wir leben von diesen drei Monaten», sagt Heuer über die Ernte. «Das können wir nicht verlegen wie die Messen oder ein Fußballspiel.»
Der Einreisestopp treffe Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe, aber auch größere Betriebe in der Tierhaltung «sehr hart», sagt auch der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied. Die Einschränkungen müssten daher «so kurz wie möglich» gehalten werden.
Einige Obst- und Gemüsesorten drohen Rukwied zufolge sogar knapp zu werden. «Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist nicht gefährdet, dennoch kann es durchaus bei verschiedenen Kulturen im Obst- und Gemüsebereich zu Versorgungslücken kommen.» Die Verbraucher müssten sich zudem auf höhere Preise einstellen: «Diese Verknappung wird auch Auswirkungen auf den Preis haben.»
So weit will Bauer Heuer nicht gehen. Er geht davon aus, fast seine gesamte Ernte einfahren zu können. Die Preise seien daher bisher auf dem Niveau des Vorjahrs. «Da hat sich nix geändert.» Holger Hennies, Vizepräsident des Landvolks, dem niedersächsischen Bauernverband, sieht dagegen in dem Mangel an Saisonarbeitern «eine echte Existenzbedrohung». Niedersachsen kann dabei stellvertretend für den Spargelanbau gesehen werden, denn nirgendwo in Deutschland wird mehr angebaut - rund 27 500 Tonnen Spargel wurden hier 2019 von den Feldern geholt, gut ein Fünftel der gesamten deutschen Spargelernte.
Hennies betont, dass es schnelle Lösungen brauche, um Engpässe auf den Feldern abzuwenden. Der Spargel müsse jetzt geerntet werden. Aber: «Keiner weiß, wer's machen soll.» Ähnliches gilt für die Aussaat anderer Gemüsesorten, etwa Brokkoli und Kohl.
Das Einreiseverbot für Saisonarbeiter gilt auf Anordnung des Bundesinnenministeriums seit vergangenem Mittwoch. Und das sorgt auch innerhalb der Union für Zoff. Vergangene Woche wandten sich CDU-Agrarpolitiker aus den 15 Bundesländern außer Bayern in einem Brief an Innenminister Horst Seehofer (CSU). Darin heißt es, die Einreisebeschränkungen seien «kontraproduktiv» und stellten die Landwirtschaft «vor eine nicht lösbare Aufgabe». Neben der Obst- und Gemüsebranche würden auch Schlachtbetriebe darunter leiden.
In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) legen Unionspolitiker nun nach - sie fordern eine Lockerung der Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und anderen EU-Mitgliedstaaten. Die deutschen Landwirte müssten in den nächsten Tagen entscheiden, welche Obst- und Gemüsesorten noch angebaut und geerntet werden könnten, daher sei keine Zeit zu verlieren, heißt es in dem Schreiben der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der Fraktion, das der dpa vorliegt. «Zur Wahrheit gehört aber, dass unser Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse im Schnitt zwischen nur 22 und 38 Prozent liegt.» Die Weichen für das Angebot ab Sommer würden jetzt gestellt.
Das Agrarministerium setzt derweil auf Unterstützung aus dem Inland. «Die Bauern alleine können das nicht schaffen», heißt es. «Wir brauchen jetzt Menschen, die bereit sind, aushilfsweise in der Landwirtschaft zu arbeiten.» Dafür wurden die Rahmenbedingungen erleichtert: Saisonarbeiter können nun länger sozialversicherungsfrei arbeiten - statt wie bisher 70 Tage sind jetzt 115 Tage möglich.
Doch wer soll die Arbeit machen? Mehrere Online-Plattformen helfen bei der Vermittlung, um überhaupt noch Saisonarbeiter zu finden. Der Bauernverband und der Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) bieten diesen Service jetzt kostenlos an. Auf einem anderen Portal der Landwirtschaftskammern meldeten sich binnen Tagen bereits rund 1000 Interessierte.
Die Hilfsangebote freuen die Landwirte. Sie sind allerdings nur eine Notlösung, wie Landvolk-Vize Hennies erklärt. «Spargelstechen ist eine Technik, die muss man können. Da muss man auch eine gewisse Leistung pro Stunde erbringen, und es muss eine vernünftige Qualität dabei herauskommen», sagt er. Die Vorstellung, dass ungelernte deutsche Helfer die Saisonkräfte aus Osteuropa ersetzen, hält er für «nicht unmöglich, aber schwierig». Spargelbauer Heuer sagt, er setze die Deutschen lieber im Verkauf und als Fahrer ein als auf dem Feld.
Auch in Brandenburg, mit Beelitz ebenfalls eine Spargel-Hochburg, sind die ungelernten Helfer derzeit gefragt. Euphorie sei allerdings fehl am Platze, sagt Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg. «Die Arbeit in der Landwirtschaft ist nicht zu verwechseln mit der im heimischen Kleingarten», erklärt er und warnt: «Es kann körperlich hart werden.»
(Text: Christopher Weckwerth, dpa)
Streit um Kurzarbeits-Vertrag
Im Streit um einen branchenweiten Kurzarbeit-Tarifvertrag für das Wach- und Sicherheitspersonal an Flughäfen hat die Gewerkschaft Verdi der Arbeitgeberseite Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. «Solch ein Vertrag würde nicht nur allen Beschäftigten Sicherheit, sondern auch den Unternehmen Orientierung bieten», teilte die Gewerkschaft am 31. März mit. «Stattdessen betreibt der BDLS nun Desinformationspolitik.»

Verdi hatte eigenen Angaben zufolge in der vergangenen Woche dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) angeboten, einen branchenweiten Vertrag für Kurzarbeit in Zeiten der Corona-Krise auszuhandeln. Dieses Angebot habe der Verband abgelehnt, noch bevor ein schriftlicher Entwurf für einen solchen Vorschlag vorgelegen habe.
Der BDLS wies direkt am Dienstag die Darstellung der Gewerkschaft zurück. «Die Gewerkschaft setzte in der vergangenen Woche das Gerücht in die Welt, dass ein Tarifvertragsabschluss zur Kurzarbeit bevorstehe», teilte der Verband mit und zitierte BDLS-Präsident Udo Hansen: «Viele unserer Mitgliedsunternehmen haben entweder bereits Vereinbarungen zur Kurzarbeit getroffen oder hatten Termine mit den Betriebsräten.» Das Vorgehen der Gewerkschaft zeuge davon, «dass man auf Gewerkschaftsseite wohl den Ernst der Lage und die wirtschaftliche Bedrohung der Unternehmen noch nicht verstanden habe.»
Die Gewerkschaft bezeichnete die Äußerungen wiederum als «wenig hilfreich und zulasten der Beschäftigten». Für die Mehrzahl der Unternehmen habe es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Betriebsvereinbarungen zum Thema gegeben, «auch wenn einige Arbeitgeber Gespräche dazu mit den Betriebsräten aufgenommen hatten».
Die Luftfahrtbranche ist von der Ausbreitung des Coronavirus schwer getroffen. Große Airlines haben den Verkehr eingestellt, die Passagierzahlen an den Flughafen sind eingebrochen. Entsprechend gering ist derzeit die Nachfrage nach den Sicherheitsdiensten.
(Text: dpa)
Fast 20 000 BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit
BMW hat für März knapp 20 000 Mitarbeiter für Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angemeldet. Die meisten von ihnen seien in den Werken Dingolfing, München, Regensburg und Leipzig beschäftigt, teilte eine Sprecherin am Dienstag ( 31. März) auf Nachfrage mit.

Der Autobauer hatte die Produktion in seinen europäischen Fabriken wegen der Corona-Krise bereits vor zwei Wochen gestoppt. Die Bänder sollen zunächst bis zum 19. April stehen - danach soll die Fertigung nach derzeitiger Planung wieder anlaufen, wie eine BMW-Sprecherin sagte.
Eine Ausnahme ist das Motorenwerk im österreichischen Steyr, das auch nach China liefert: In Steyr soll schon ab kommendem Montag wieder gearbeitet werden. Im SUV-Werk Spartanburg in den USA steht die Produktion erst seit dieser Woche, sie soll schon sofort nach Ostern wieder anlaufen.
Wegen der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Autos deutlich zurückgegangen, viele Händler in Europa haben geschlossen. Auch viele Zulieferer lassen die Arbeit ruhen.
(Text: dpa)
Samstagsarbeit bei Volksbanken
Die Gewerkschaften DBV und DHV dulden wegen der aktuellen Belastungen bis Ende Mai Samstagsarbeit in Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken. Eine entsprechende Sonderregelung vereinbarten die Tarifpartner mit dem Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (AVR).

Die Tarifpartner hätten sich in der aktuellen Ausnahmesituation darauf verständigt, «den Betriebsparteien zu signalisieren, dass sie für einen vorübergehenden Zeitraum eine Ausdehnung der Samstagsarbeit über die tariflich geregelten Tatbestände hinaus dulden wollen», erklärte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) am Donnerstag, 26. März.
Zum einen soll so Eltern ermöglicht werden, Arbeit und Kinderbetreuung besser in Einklang zu bringen, teilten die Tarifpartner mit. Zum anderen gebe dies den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, die aktuelle Flut an Kreditanträgen im Zuge der Corona-Krise auch in einer Samstagsschicht abzuarbeiten.
«Auch wenn der Samstag für uns ein hohes Gut ist, haben wir uns daher entschlossen, ihn bis Ende Mai weitgehend freizugeben - Freiwilligkeit des Einsatzes immer vorausgesetzt», sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Bankangestellten-Verbandes (DBV), Stephan Szukalski. Nach dem 31. Mai ende die befristete Möglichkeit für Samstagseinsätze automatisch.
Die Gewerkschaft Verdi, die seit 2008 nicht mehr Tarifpartner der Volks- und Raiffeisenbanken ist, teilte auf Anfrage mit, sie habe der Samstagsarbeit in den Volks- und Raiffeisenbanken nicht zugestimmt. «Wir sehen aktuell auch keinerlei Veranlassung Samstagsarbeit durchzuführen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass einige Volks- und Raiffeisenbanken die aktuelle Krise zur Aufweichung bestehender Regelungen ausnutzen könnten», erklärte ein Verdi-Sprecher.
(Text: dpa)
Thyssenkrupp streicht jede zehnte Stelle beim Stahl
Bei Thyssenkrupp sind die Weichen für den Abbau von mehr als jedem zehnten Arbeitsplatz im Stahlbereich gestellt. Der größte deutsche Stahlkocher hat sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Tarifvertrag geeinigt, der den Abbau von 3000 der rund 28 000 Stellen ohne betriebsbedingte Kündigungen regelt. Die Beschäftigungssicherung gilt bis zum 31. März 2026, wie Thyssenkrupp am Mittwoch (25. März) mitteilte.

Vom Stellenabbau sind 2000 Mitarbeiter in der Produktion und 1000 in der Verwaltung betroffen. Die im Tarifvertrag vereinbarten Investitionen beim Stahl seien eine «absolut gute Botschaft» für die Beschäftigten, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Thyssenkrupp Steel Europe, Tekin Nasikkol.
Der Ruhrgebietskonzern muss seinen rote Zahlen schreibenden Stahlbereich im Alleingang sanieren, nachdem die EU-Kommission im vergangenen Jahr die lange vorbereitete Fusion mit der europäischen Stahlsparte des indischen Konkurrenten Tata untersagt hatte. In einem ersten Schritt ist ein Abbau von bis zu 2000 Stellen in den nächsten drei Jahren vorgesehen. Weitere etwa 1000 Stellen sollen bis 2026 wegfallen. Die Vereinbarung gebe Thyssenkrupp deutlich mehr Flexibilität, Mitarbeiter auf andere Stellen zu versetzen, betonte der Konzern.
Thyssenkrupp will das Zentrum seiner Stahlproduktion in Duisburg stärken. Dazu werden unter anderem Produktionskapazitäten von Bochum an den Rhein verlagert. «Wir investieren in einen der besten Stahlstandorte weltweit», sagte Klaus Keysberg, im Konzernvorstand für den Stahlbereich zuständig. Die neue Strategie sehe einen zusätzlichen Investitionsrahmen von insgesamt etwa 800 Millionen Euro über sechs Jahre vor. Hinzu kämen die bereits in der Planung enthaltenen jährlichen Investitionen von rund 570 Millionen Euro.
Betriebsrat und IG Metall hatten Thyssenkrupp seit langem vorgeworfen, zu wenig in den Stahl zu investieren. Auch der Stahlvorstand hatte eingeräumt, dass einige Anlagen nicht mehr dem
Stand der Technik entsprächen und «große Qualitätsprobleme» bereiteten. «Wir haben Probleme zu lange aufgeschoben und harte Entscheidungen gescheut», sagte Keysberg. Der chronisch unterfinanzierte Stahl bekomme «endlich die Gelder, die benötigt werden», sagte der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler. Thyssenkrupp werde deutlich schneller und in besserer Qualität an die Autoindustrie liefern können, sagte Betriebsratschef Nasikkol.
In Duisburg soll aber auch abgebaut werden. Thyssenkrupp will sich dort von der Grobblechproduktion, in der 800 Menschen beschäftigt sind, trennen. Wenn bis Ende des Jahres kein Käufer gefunden wird, soll die Produktionsanlage geschlossen werden. In Bochum wird einer von zwei Standorten geschlossen, Arbeitsplätze werden in das verbleibende Werk verlagert, das zu einem Zentrum für die Elektromobilität ausgebaut werden soll. In der Summe sollen in Bochum etwa 400 Arbeitsplätze verloren gehen.
Das Geld für die zusätzlichen Investoren soll aus den Erlösen des Verkaufs der Aufzugssparte von Thyssenkrupp kommen. Der Konzern will seinen profitabelsten Geschäftsteil für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkaufen. Das im vergangenen Monat abgeschlossene Geschäft sei durch die Corona-Krise nicht gefährdet, hieß es in Konzernkreisen.
Die Virus-Pandemie wird in den Stahlwerken von Thyssenkrupp zu erheblicher Kurzarbeit führen. «Wir werden an vielen Standorten in den nächsten Wochen in Kurzarbeit gehen müssen», sagte Personalvorstand Oliver Burkhard. Die Vereinbarung mit der Gewerkschaft enthält deshalb ein Sofortpaket zur Corona-Krise. Unter anderem ist die Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 80 Prozent vorgesehen. Zudem soll eine tariflich vereinbarte Sonderzahlung von 1000 Euro in fünf freie Tage umgewandelt werden. Die Kurzarbeit werde wahrscheinlich ab Mai für drei Monate beginnen, sagte Nasikkol.
(Text: dpa)