Millionen mit Nebenjobs
chwindende Tarifverträge, finanzielle Schwierigkeiten und besondere Konsumwünsche: Die Zahl der Menschen mit Nebenjob in Deutschland ist auf einen neuen Rekord gestiegen. Ende Juni 2019 waren rund 3,54 Millionen Mehrfachbeschäftigte registriert, wie aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht. Mit fast drei Millionen Menschen haben die meisten davon neben einem regulären Job noch einen Minijob. Die Daten liegen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Die «Neue Osnabrücker Zeitung» (21. Januar) berichtete zuerst darüber.

m Juni 2018 hatten noch rund 124 000 Menschen weniger einen Nebenjob. Der Anstieg beträgt 3,6 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es erst 2,33 Millionen Mehrfachbeschäftigte. Ihr Anteil an den Beschäftigten insgesamt stieg von damals 7,1 auf 9,2 Prozent. 2003 gingen erst 1,39 Millionen Menschen mehreren Jobs nach. Damals waren geringfügige Beschäftigungen im Zuge der Hartz-Reformen von Sozialversicherungspflicht und Einkommensteuer freigestellt worden.
Mehr als 345 400 Menschen gingen im vergangenen Jahr zwei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen nach. Dritthäufigste Variante war die Kombination von zwei oder mehr Minijobs. Dies galt für knapp 260 700 Fälle.
REAKTIONEN: «Der überwiegende Teil dürfte aus purer finanzieller Not mehr als einen Job haben und nicht freiwillig», kritisierte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mahnte, nicht jede Form von Nebenbeschäftigung zu skandalisieren. «Aber es gibt Bereiche, da muss uns das mit Sorge umtreiben», sagte Heil bei der Vorstellung eines neuen «Rats der Arbeitswelt». «Tatsache ist: Wir haben nach wie vor in Deutschland einen sehr festen Sockel von Niedriglöhnen, und darüber müssen wir reden.» Insgesamt arbeiteten laut Bundesagentur für Arbeit zuletzt 4,14 Millionen Menschen im unteren Lohnbereich, also landeten unter zwei Drittel des mittleren Einkommens, also weniger als 2203 Euro.
MOTIVATION: Laut einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie des Instituts WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stifgung sind für 53 Prozent der Befragten finanzielle Schwierigkeiten ausschlaggebend gewesen, eine Nebentätigkeit aufzunehmen. 24 Prozent konnten keine Vollzeitstelle finden. Für 51 Prozent war die Erfüllung von besonderen Konsumwünschen entscheidend. Für 58 Prozent ist die Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Menschen entscheidend gewesen. Knapp die Hälfte der Befragten hat eine Nebentätigkeit aufgenommen, um anderen Menschen helfen zu können. Weitere Motive: die Verwirklichung einer Leidenschaft und die Erweiterung beruflicher Perspektiven. Bei der Befragung waren mehrere Antworten möglich.
WEITERE HINTERGRÜNDE: Auch eine Studie, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schon 2017 vorgelegt hatte, deutet darauf hin, dass viele Nebenjobber auf das Geld angewiesen sind. Demnach bekommen Nebenjobber in ihrer Hauptbeschäftigung im Schnitt etwa 570 Euro im Monat weniger als Menschen mit nur einem Job. Bei der Kombination einer sozialversicherungspflichtigen Stelle mit einem Minijob sind 28,5 Prozent der Zweitjobs in allgemeinen Dienstleistungsberufen.
ABHILFE: Zimmermann forderte die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, die Abschaffung von Niedriglohnbeschäftigung in Form der Leiharbeit und von sachgrundlosen Befristungen. Minijobs müssten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden. Heil wies darauf hin, dass Niedriglöhne auch daraus resultierten, dass immer weniger Arbeitsplätze an Tarifverträge gebunden seien. Im Jahr 2018 waren laut DGB zufolge nur noch 56 Prozent der Beschäftigten im Westen und 45 Prozent im Osten tarifgebunden.
(Text: dpa)
Zur Erprobung von Mitarbeitern
Unternehmen in Deutschland befristen Jobs in den meisten Fällen zur Erprobung der Mitarbeiter. Das zeigt eine am Dienstag, 21. Januar, in Berlin vorgestellte Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland zuvor berichtet hatte. Demnach ist die Erprobung von Beschäftigten der mit 42 Prozent am häufigsten genannte Grund von Befristungen in der Privatwirtschaft. Danach folgen zeitlich begrenzter Mehrbedarf, eine unsichere wirtschaftliche Perspektive und begrenzter Ersatzbedarf.
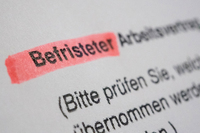
Dazu kommen noch 2 Prozent von Betrieben, die als Hauptgrund nennen, eine Befristung steigere die Motivation der Beschäftigten. Wenn Arbeitgeber mehrere Gründe gleichzeitig angeben können, sagen dies sogar mehr als zehn Prozent. In vielen Fällen würden Befristungen aus dem einfachen Grund eingesetzt, dass sie möglich seien, so der DGB. Für seine Studie wertete er repräsentative Arbeitgeberbefragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus.
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sachgrundlose Befristungen per Gesetz eindämmen. Sachgründe können etwa bestimmte Projekte eines Unternehmens sein, Vertretungen wie bei Elternzeit oder auch die Erprobung eines Mitarbeiters. Der Anteil von Befristungen bei den Arbeitsverträgen lag laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Jahr 2018 in der Privatwirtschaft bei 7,1 Prozent, im öffentlichen Dienst bei 8,9 Prozent. Rund 1,46 Millionen oder 38 Prozent der Neueinstellungen waren befristet, der Großteil davon ohne Sachgrund.
(Text: dpa)
Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern steigt weiter
In Deutschland sind rund 700.000 Erzieherinnen und Erzieher sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl um ein Drittel gestiegen. „Der Erzieherberuf hat stark an Bedeutung gewonnen“, erklärt die IAB-Forscherin Anja Warning. Ursache sei vor allem der Ausbau der Kindertagesbetreuung, dem Haupttätigkeitsfeld von Erzieherinnen und Erziehern.

Daten der IAB-Stellenerhebung, einer repräsentativen Arbeitgeberbefragung, zeigen überdurchschnittlich starke Rekrutierungsprobleme im Erzieherberuf. Während es bei Stellenausschreibungen in anderen Berufen durchschnittlich elf Bewerbungen gibt, sind es bei Erzieherstellen nur fünf. Bei der Hälfte der Stellenbesetzungen im Erzieherbereich gibt es aus Arbeitgebersicht Probleme wie zu wenig Bewerbungen oder unzureichende Qualifikationen der Bewerber. Die Personalsuche dauert auch überdurchschnittlich lange: So vergehen im Durchschnitt mehr als 100 Tage zwischen dem Beginn der Suche durch den Arbeitgeber und dem tatsächlichen Arbeitsbeginn der eingestellten Person. Die Besetzung dauert bei anderen Berufen im Schnitt weniger als 90 Tage.
„Arbeitgeber haben bei Erzieherstellen große Schwierigkeiten, Personal zu finden, ähnlich wie in Fachkraft-Berufen im Bereich Gesundheit und Pflege“, stellt Warning fest. Auch der OECD zufolge sei der Erzieherberuf in Deutschland ein Engpassberuf.
Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung und das relativ hohe Alter der Beschäftigten in diesem Beruf werden den Bedarf an Fachkräften in naher Zukunft weiter steigern. „Es ist Dringlichkeit gegeben, die Attraktivität des Berufs und der Erzieher-Ausbildung zu verbessern, um das Angebot an ausgebildeten Fachkräften deutlich zu erhöhen“, so Warning. Ansatzpunkte seien eine weitere Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze, die Vergütung des bislang unbezahlten schulischen Ausbildungsanteils und vermehrte Möglichkeiten zum Quereinstieg. Darüber hinaus sei es wichtig, die Arbeitsbedingungen im Beruf zu verbessern, um diesen attraktiver zu machen.
„Kindertagesstätten können bei Personalmangel kurzfristig nicht über eine Verringerung der Zahl der zu betreuenden Kinder gegensteuern. Unbesetzte Stellen bringen deshalb besonders hohe Belastungen beim vorhandenen Personal mit sich. Personalmangel gefährdet die Qualität der Bildungsarbeit und nicht zuletzt die Attraktivität des Erzieherberufes“, schreibt Warning.
An der IAB-Stellenerhebung nehmen mehr als 10.000 Betriebe teil.
(Text: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB))
Mindestlöhne kontrollieren
Damit Mindestlöhne in Betrieben eingehalten werden, bedarf es mehr und effektiverer Kontrollen. Aufgrund intransparenter Arbeitsbedingungen, unterschiedlicher Regelungen für bestimmte Arbeitsformen und immer komplexerer Zuliefererketten ist die Überprüfung für die zuständigen Behörden heute viel schwieriger als in der Vergangenheit. „Für eine wirksame Abschreckung müssen Kontrollen an der Spitze der Wertschöpfungskette ansetzen, nicht erst auf der Baustelle oder im Supermarkt“, fordert ein aktueller Report aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE).

Das IAQ-Team mit Prof. Dr. Gerhard Bosch, Frederic Hüttenhoff und Dr. Claudia Weinkopf hat die Probleme bei der Durchsetzung (Enforcement) und Einhaltung (Compliance) von Mindestlöhnen untersucht und liefert damit eine erste umfassende empirische Untersuchung zur Kontrolle von Mindestlöhnen in Deutschland.
Probleme sieht das IAQ-Team vor allem in Risikobranchen mit vielen Kleinbetrieben, wechselnden Arbeitszeiten und Einsatzorten sowie in Firmen ohne Tarifbindung und ohne Betriebsräte. Viele Beschäftigte wissen gar nicht, welche Lohnbestandteile auf den Mindestlohnanspruch angerechnet werden dürfen. Bei Verstößen müssen sie in Deutschland selbst vor Gericht ziehen, um vorenthaltene Entgelte einzuklagen. Das machen aber nur wenige.
Wenn die Kontrollkräfte nur auf Hinweise reagieren, sind überdies schnell alle Ressourcen verbraucht, ohne die Verhaltensweisen in der Wirtschaft nachhaltig zu verändern. Das IAQ-Team setzt deshalb auf Prävention: Um die Selbstkontrollen durch die Sozialpartner zu stärken, müsste die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen, d.h. die Übertragung tarifvertraglicher Rechtsnormen auf bisher nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte, deutlich erleichtert werden.
Unternehmen an der Spitze von Wertschöpfungsketten wie im Baugewerbe sollten selbst dafür sorgen, dass auch ihre Subunternehmen Mindeststandards einhalten. Diese gehörten in die Entscheidungs- und Produktionsprozesse eingebaut; auch müssten verbindliche Compliance-Vereinbarungen mit Generalunternehmen abgeschlossen werden.
Das IAQ betont außerdem, dass Beschäftigte wissen müssen, was zur bezahlten Arbeitszeit zählt und was nicht. Dafür bedarf es einer manipulationssicheren Erfassung der Arbeitszeit, auf die die Beschäftigten jederzeit das Recht zur Einsicht haben. Schließlich ließe sich auch die Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen verbessern. So könnten die Kontrollbehörden den Geschädigten Erkenntnisse aus den Prüfungen für gerichtliche Verfahren zur Verfügung stellen.
(Text: Universität Duisburg-Essen)
Zahlreiche weitere Arbeitsplätze nach BER-Eröffnung
Nach der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER in diesem Jahr könnte der Luftverkehr nach einer Studie Tausende weitere Arbeitsplätze sichern. Hingen 2016 umgerechnet etwa 40 000 Vollzeitstellen direkt oder indirekt von den Flughäfen Tegel und Schönefeld ab, könnten es 2035 etwa 60 000 bis 70 000 sein, kündigten Wirtschaftswissenschaftler am gestrigen Montag (20. Januar) in Schönefeld an.

Treiber der Entwicklung seien zusätzliche Passagiere und mehr Innovation und Effizienz durch den neuen Flughafen, sagte der Leipziger Unternehmensberater Thomas Lehr. Er hatte die Beschäftigungseffekte mit Oliver Rottmann von der Uni Leipzig prognostiziert und auf Einladung des Flughafens präsentiert.
Der BER soll nach neun Jahren mit Planungsfehlern, Baumängeln und langwierigen Sanierungen im Oktober in Betrieb gehen. «Wir haben fast alles fertig, und zwar richtig fertig», sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Eine Sache fehle noch: «Wir müssen bei der Sicherheitsverkabelung und der Notstromversorgung die Prüfungen bis Ende März abschließen, dann können wir "fertig" melden.» Im April soll der Probebetrieb beginnen.
Seit Mitte Januar werden Flughafenmitarbeiter aus Tegel und Beschäftigte von Flughafenkunden wie etwa Fluggesellschaften in Schönefeld geschult. Für Passagiere am Bahnhof Schönefeld ist das nicht zu übersehen: Zahlreiche Wegweiser führen zu Sonderbussen «Richtung Schulungen/Probetrieb» am BER.
Berlins IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder forderte bei der Präsentation für den BER mehr Rechte für Langstrecken nach Nahost und Südostasien. «Wir haben den Flughafen viel zu klein gedacht», sagte Eder. «Wir werden das dritte Terminal bauen müssen.»
(Text: dpa)
Arbeiten am Limit
Nur 13 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bewerten ihre Arbeitsbedingungen grundsätzlich gut. Ein Fünftel arbeitet unter schlechten Bedingungen. Insbesondere die hohen Arbeitsbelastungen und die damit verbundenen Probleme treiben die Menschen um. Das sind zentrale Ergebnisse des DGB-Index Gute Arbeit 2019.

Die Arbeitsintensität liegt seit Jahren auf einem hohen Niveau. Damit sind für viele Beschäftigte starke psychische Belastungen verbunden. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, sehr häufig oder oft unter Zeitdruck arbeiten zu müssen. Ein Viertel der Befragten können die von ihnen geforderte Arbeitsmenge nicht in der vereinbarten Arbeitszeit bewältigen. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Wer unter Arbeitsüberlastung leidet, lässt Erholungspausen häufiger ausfallen und geht auch trotz Krankheit häufiger zur Arbeit. Knapp 60 Prozent der Betroffenen fühlen sich nach der Arbeit oft leer und ausgebrannt.
Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender: „Viele Beschäftigte arbeiten am absoluten Limit. Arbeitsstress gefährdet die Gesundheit und darf nicht zur Regel werden. Hier liegt die Verantwortung ganz klar bei den Arbeitgebern. Sie müssen die Überlastung und die damit einhergehenden gesundheitlichen Gefährdungen der Beschäftigten vermeiden. Die Gewerkschaften haben zahlreiche Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zum Schutz der Gesundheit abgeschlossen. Diese müssen zum Standard für alle Beschäftigten werden. Deshalb fordern wir die Koalition auf, die Tarifbindung und die Mitbestimmung zu stärken. Die allseits beschworene Fachkräftesicherung muss vor allem im Betrieb selbst anfangen – mit gesunden Arbeitsbedingungen.“
Darüber hinaus forderte Hoffmann eine Modernisierung des Arbeitsschutzgesetzes. „Das zentrale Manko ist seit Jahren, dass der Großteil der Betriebe die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen gar nicht durchführt. Das ist angesichts der hohen psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ein Armutszeugnis. Deshalb brauchen wir – insbesondere in Zeiten einer sich rasant verändernden Arbeitswelt – ein Update beim Arbeitsschutz.“
Guido Zeitler, Vorsitzender der NGG: „Der Index zeigt deutlich: Die Arbeitsverdichtung steigt und damit auch die Arbeitsbelastung in den Berufen der Lebensmittelindustrie und des Gastgewerbes. Zunehmende Hetze und Stress machen krank. Es ist ein deutliches Alarmsignal, wenn mehr als 60 Prozent der Beschäftigten im Gastgewerbe sagen, nicht bis zum Rentenalter arbeiten zu können. Deshalb sind auch die Bestrebungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, das Arbeitszeitgesetz zu schleifen, der völlig falsche Ansatz. Wir brauchen mehr statt weniger Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt.“
Zum Index: Mit dem DGB-Index Gute Arbeit werden seit 2007 einmal im Jahr abhängig Beschäftigte zur Qualität ihrer Arbeitsbedingungen befragt. Die Ergebnisse spiegeln die Sicht der Beschäftigten auf ihre Arbeitsbedingungen wider; auf dieser Basis beschreibt der DGB-Index Gute Arbeit die Arbeitsqualität in Deutschland. 2019 wurden bundesweit über 6.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Branchen, Berufe, Einkommens- und Altersgruppen, Regionen und Betriebsgrößen befragt. Neben den jährlichen Fragen zur Arbeitsbelastung, dem Einkommen, dem Sinn der Arbeit und der Ressourcenausstattung lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der Arbeitsintensität und ihren gesundheitlichen Folgen.
(Text: Deutscher Gewerkschaftsbund)
Ärztinnen und Ärzte in Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen
Der Marburger Bund ruft seine Mitglieder in den tarifgebundenen Universitätskliniken der Länder für den 4. Februar 2020 zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Ärztinnen und Ärzte in den betroffenen Unikliniken sollen an diesem Tag nach Hannover kommen, wo vor den erneuten Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) eine zentrale Kundgebung des Marburger Bundes stattfinden wird.

„Der Marburger Bund hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte in den Unikliniken substanziell zu verbessern. In den beiden bisherigen Verhandlungsrunden haben die Länder jedoch keine Bereitschaft erkennen lassen, konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Ärzte zu vereinbaren. Stattdessen äußerte die TdL die Befürchtung, durch verbindliche Regelungen zur Begrenzung der Dienstbelastung könnten betriebliche Abläufe gestört werden. Daran zeigt sich, dass die Arbeitgeber den Ernst der Lage noch nicht verstanden haben. Unsere Mitglieder werden darauf eine entsprechend deutliche Antwort geben“, kündigte Dr. Andreas Botzlar, 2. Vorsitzender des Marburger Bundes, an.
Die TdL habe in den bisherigen Verhandlungen den Eindruck vermittelt, als seien ungeregelte Arbeitszeiten, fehlende Arbeitszeiterfassungen, pauschale Kappungen der geleisteten Arbeitszeit, ungeplante Inanspruchnahmen und regelmäßige Wochenenddienste bei einer Anstellung in einem Universitätsklinikum billigend in Kauf zu nehmen. Diese Anmaßungen nähmen die Ärztinnen und Ärzten in den Unikliniken nicht länger hin. „Ohne eine wirksame Entlastung wird die ärztliche Tätigkeit in der Universitätsmedizin unattraktiv. Spitzenmedizin braucht gute Arbeitsbedingungen und eine faire Vergütung. Das muss endlich auch in die Köpfe der TdL-Vertreter“, bekräftigte Botzlar.
Der Marburger Bund fordert in der Tarifrunde mit der TdL neue Bedingungen für die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst. So sollen solche Dienste an maximal zwei Wochenenden im Monat angeordnet werden dürfen. Zu der angestrebten Reform gehören auch eine generelle Begrenzung der Bereitschaftsdienste, eine verlässliche Dienstplangestaltung und eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung ohne pauschale und nachträgliche Kappungen der geleisteten Arbeitszeit. Weiterhin fordert der Marburger Bund sechs Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr und eine Neuregelung des Zusatzurlaubes für Nachtarbeit.
Der Tarifvertrag (TV-Ärzte) gilt für rund 20.000 Ärztinnen und Ärzte in bundesweit 23 Universitätskliniken. Eine Reihe von Unikliniken unterfallen nicht oder nur sehr eingeschränkt dem Geltungsbereich des TV-Ärzte. So haben Berlin und Hessen eigene Tarifverträge für die Ärzte an den dortigen Unikliniken, die von den Landesverbänden des Marburger Bundes ausgehandelt werden. Die Universitätsklinika in Hamburg und Mannheim unterfallen den Regelungen des kommunalen TV-Ärzte/VKA. Für die Ärztinnen und Ärzte der Universitätsmedizin Mainz existiert ein vom Landesverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz abgeschlossener Haustarifvertrag.
Weitere Informationen zu den Forderungen des Marburger Bundes unter www.tdl-tarifrunde.de.
(Text: Marburger Bund)
Varta schafft 600 neue Arbeitsplätze
Der Batteriehersteller Varta baut wegen der ungebrochen steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen seine Produktion schneller als ursprünglich gedacht aus. Dies geht auch mit einem Aufbau von rund 600 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland einher, wie das MDax-Unternehmen am 16. Januar in Ellwangen mitteilte. Dafür kündigte der Konzern zusätzliche Investitionen von rund 125 Millionen Euro an.

Nachdem die Planungen ursprünglich bereits auf mehr als 150 Millionen Zellen jährlich ab 2022 angehoben worden waren, legt Varta nun noch eine Schippe drauf. So sollen die Produktionskapazitäten auf 200 Millionen Zellen jährlich ausgebaut werden, wobei die Erweiterung bereits bis Ende 2021 umgesetzt werden soll. Bereits bis Mitte dieses Jahres will Varta in der Lage sein, mindestens 100 Millionen Zellen jährlich herzustellen. Finanziert werden soll das Vorhaben auch aus dem operativen Barmittelfluss. Zudem stehen dem Konzern zufolge eine Kreditlinie zur Verfügung.
(Text: dpa)
Trotz Urlaubssperre: Arbeitgeber muss jeden Urlaubsantrag prüfen
Beantragen Arbeitnehmer Urlaub, muss der Arbeitgeber ihre Wünsche berücksichtigen. Es sei denn, dringende betriebliche Gründe sprechen dagegen. Der Verweis auf eine allgemeingültige Urlaubssperre in der Weihnachtszeit reicht aber nicht aus, um einen Antrag abzulehnen.

Das zeigt ein Urteil des Arbeitsgerichts Braunschweig (Az. 4 Ca 373/19), über das der Bund-Verlag berichtet. In dem Fall hatte eine Pflegeassistentin bei ihrem Arbeitgeber, einer Pflegeeinrichtung, zwei Wochen Urlaub zum Jahresende beantragt. Sie wollte Weihnachten mit ihrer Familie verbringen. Der Arbeitgeber lehnte den Antrag ab. Zu dieser Zeit gelte eine mit dem Betriebsrat vereinbarte Urlaubssperre.
Die Pflegekräfte bekämen jeweils über die Weihnachtstage oder zum Jahreswechsel einige Tage frei. Eine zweiwöchige Abwesenheit könne dazu führen, dass mehr Pflegekräfte an Weihnachten oder Silvester arbeiten müssen. Denn üblicherweise sei in dieser Zeit mit einem hohen Krankenstand zu rechnen.
Dem Gericht reichte diese Darlegung nicht aus, um dringende betriebliche Gründe vorzuweisen. Dazu gehören zum Beispiel genaue Angaben zum Personalbedarf sowie zu den Fehlzeiten, mit denen der Arbeitgeber rechnet. Auch wenn eine Urlaubssperre vorliegt, muss jeder Urlaubsantrag einzeln geprüft werden. Der Arbeitgeber musste der Pflegeassistentin den beantragten Urlaub gewähren.
(Text: dpa-tmn)
Real-Betriebsrat schlägt Alarm
Durch die geplante Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real ist nach Einschätzung des Betriebsrates fast jeder Dritte der noch vorhandenen 34 000 Arbeitsplätze bei der Metro-Tochter gefährdet. «Der Gesamtbetriebsrat rechnet mit etwa 10 000 Arbeitslosen», sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Unternehmens, Werner Klockhaus der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag, 14. Januar).

Der Hintergrund: Die Metro will alle 277 Real-Märkte in Deutschland und den Online-Shop real.de möglichst noch in diesem Monat an ein Investoren-Konsortium aus X-Bricks und SCP Group verkaufen. Die künftigen Eigentümer wollen aber nach den bisher bekanntgewordenen Plänen nur einen kleinen Teil der Real-Märkte selbst weiter betreiben. Der Großteil der Standorte soll an andere Händler wie Edeka oder Kaufland weiterverkauft werden. Einigen Standorten droht offenbar auch die Schließung.
Eine Metro-Sprecherin betonte angesichts der Befürchtungen des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden, die Wahrung der Mitarbeiterinteressen sei für den Konzernvorstand ein zentrales Thema in den Verkaufsgesprächen. «Wir setzen uns dafür ein, dass mit den Märkten auch die Mitarbeiter von den übernehmenden Unternehmen weiterbeschäftigt werden.» Ein Sprecher von X-Bricks wollte die Äußerungen von Klockhaus nicht kommentieren.
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende malte in dem Interview die Zukunft für viele Beschäftigte der Handelskette in düsteren Farben. Er rechne mit «rund 50 Schließungen oder mehr» im Zuge der Neuordnung. Allein dadurch seien rund 6000 Arbeitsplätze bedroht. Außerdem werde es wohl auch in den an Wettbewerber verkauften Filialen zu sehr vielen betriebsbedingten Kündigungen kommen, befürchtet er. Denn kaum einer der Wettbewerber habe eine ähnlich breite Sortimentsstruktur wie Real. Die Beschäftigen in der Elektro-, Sport- und Haushaltswarenabteilung würden deshalb nicht mehr benötigt. Zusammen mit dem zu erwartenden Personalabbau in der Zentralverwaltung seien damit noch einmal 4000 Stellen gefährdet.
Mit dem Verkaufsprozess vertraute Personen bewerteten die Zahlen des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden allerdings als sehr spekulativ. Die künftigen Eigentümer hätten schon aus Kostengründen ein Interesse daran, möglichst viel Märkte und damit auch möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, hieß es.
Die Metro-Sprecherin verwies außerdem auf eine Ende letzten Jahres von Real unterzeichnete Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat. Sie sehe eine soziale Absicherung für alle Real-Beschäftigten vor, die trotz aller Bemühungen durch betriebsbedingte Kündigungen ihren Arbeitsplatz bei einem der übernehmenden Unternehmen verlieren.
Klockhaus sieht in der Regelung allerdings nur einen Notbehelf. Sie solle verhindern, «dass die Beschäftigten ins Bodenlose fallen». Maximal werde es 12 oder 14 Bruttomonatsgehälter Abfindung geben. Angesichts der niedrigen Löhne im Einzelhandel und der vielen Teilzeitbeschäftigten sei dies auch bei langjähriger Betriebszugehörigkeit keine große Summe.
«Für die Metro war Real schon immer ein Stiefkind, welches man vernachlässigt hat», klagte Klockhaus. Die Zeche dafür müssten jetzt die Mitarbeiter zahlen. Auch von der Politik hätten die Beschäftigen bislang keine Hilfe erfahren.
Real kämpft mit sinkenden Umsätzen und roten Zahlen. Schon seit geraumer Zeit sucht die Metro nach einem Käufer für die Handelskette. Doch erwies sich der Verkaufsprozess als viel mühsamer als zunächst erwartet.
(Text: dpa)