Existenzgründer wichtig für Arbeitsmarkt
Gründer neuer Unternehmen haben im vergangenen Jahr Zehntausende neue Jobs geschaffen. Umgerechnet in Vollzeitstellen entstanden 219 000 Arbeitsplätze, wie aus Daten der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. «Das zeigt, wie relevant Neugründungen für die Beschäftigung in Deutschland sind», heißt es im aktuellen KfW-Gründungsmonitor. 2017 wurden 145 000 neue Jobs verzeichnet, ein Jahr zuvor waren es 215 000.
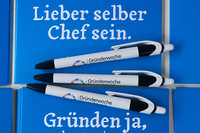
Möglicherweise wären es im vergangenen Jahr sogar mehr Jobs gewesen. Doch gerade die jungen Unternehmen haben es den Angaben zufolge oft schwerer, Mitarbeiter für sich zu gewinnen als etablierte Firmen. So berichteten 20 Prozent der Existenzgründer über Probleme bei der Stellenbesetzung.
Generell sinkt angesichts des boomenden Arbeitsmarkts das Interesse vieler Menschen an einer Selbstständigkeit. Den Angaben zufolge machten sich im vergangenen Jahr 547 000 Menschen selbstständig, das waren 2 Prozent weniger als 2017. In der Vergangenheit hatte es allerdings noch Rückgänge mit jeweils zweistelligen Raten gegeben.
«Die gute Konjunktur hat der Gründungstätigkeit im vergangenen Jahr positive Impulse gegeben und die negativen Effekte der weiterhin hervorragenden Lage am Arbeitsmarkt abgebremst», fasste KfW-Experte Georg Metzger die Entwicklung zusammen.
Am Laufen gehalten wurde das Gründungsgeschehen von Frauen. 216 000 Existenzgründerinnen wagten den Schritt in die Selbstständigkeit, das waren 4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der männlichen Existenzgründer sank dagegen um 5 Prozent auf 331 000. Knapp die Hälfte der Frauen nannte bei der KfW-Befragung Unabhängigkeit als wichtigstes Motiv. Bei Männern waren es 35 Prozent.
Positiv bewertet die KfW den seit 2015 gestiegenen Anteil von Existenzgründern, die bestehende Unternehmen übernehmen. «Angesichts der hohen Zahl an Mittelständlern, bei denen in absehbarer Zeit eine Nachfolge ansteht, ist das eine gute Nachricht», sagte Metzger.
Die Gründung neuer Unternehmen liegt mit weitem Abstand allerdings vorn. 2018 waren es den Angaben zufolge so viele wie nie zuvor: 8 von 10 Existenzgründern machten sich selbstständig, indem sie unternehmerische Strukturen erstmalig aufbauten.
An der Spitze steht den Angaben zufolge weiterhin Berlin. Dort machten sich im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 von 10 000 Erwerbsfähigen jährlich 193 Menschen selbstständig. Auf Rang zwei folgte erneut Hamburg mit 146 Gründern. In beiden Städten sorgten vor allem die Medien- und IT-Branche mit ihren hohen Anteilen von Freiberuflern für eine starke Gründerszene.
Brandenburg schob sich von den achten auf den dritten Platz nach vorn. Vermutlich strahle die überdurchschnittliche Aktivität in Berlin in die Peripherie der Hauptstadt aus, hieß es. Auf den Plätzen vier und fünf liegen nach wie vor Bayern und Nordrhein-Westfalen. Schlusslicht war Thüringen mit 74 Gründern je 10 000 Erwerbsfähigen.
Die ostdeutschen Flächenländer stehen den Angaben zufolge mit Ausnahme Brandenburgs regelmäßig am Ende des Länderrankings. «Dort belastet eine im Durchschnitt geringere Kaufkraft die Gründungstätigkeit», heißt es in der Studie. Hinzu komme die ältere Bevölkerungsstruktur. Die Bereitschaft sich selbstständig zu machen, nehme in der Regel mit dem Alter ab.
(Text: dpa)
Beim Urlaubsgeld geht jeder Zweite leer aus
Nur knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Und die Chancen darauf sind alles andere als gleich verteilt: Frauen gehen öfter leer aus als Männer. Beschäftigte im Westen haben größere Chancen darauf als Arbeitnehmer im Osten. Und auch die Größe des Betriebs und die Frage der Tarifbindung spielen eine entscheidende Rolle, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auf Grundlage einer Online-Befragung von mehr als 123 000 Beschäftigten mitteilte.

Die größten Chancen, ein Urlaubsgeld zu erhalten, haben nach Angaben des Leiters des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen. Rund 69 Prozent von ihnen erhalten der Umfrage zufolge einen Gehaltszuschuss für die schönsten Wochen des Jahres. Zum Vergleich: Bei den Beschäftigten, für die kein Tarifvertrag gilt, sind es lediglich 36 Prozent.
Durchschnittlich können 50 Prozent der Männer, aber nur 41 Prozent der Frauen mit Urlaubsgeld rechnen. Hier komme zum Tragen, dass in den Berufen mit einem hohen Männeranteil - etwa bei Ingenieurberufen und bei anderen technischen Tätigkeiten - überdurchschnittlich häufig Urlaubsgeld gezahlt werde, berichtete Schulten. In Berufen mit hohem Frauenanteil - etwa im Sozial- und Gesundheitsbereich - sei dies deutlich seltener der Fall.
Auch die Region, in der man arbeitet, spielt eine große Rolle. Während im Westen fast die Hälfte (49 Prozent) der Beschäftigen einen Zuschuss zur Urlaubskasse bekommt, ist das in den ostdeutschen Bundesländern nur bei gut einem Drittel der Arbeitnehmer (35 Prozent) der Fall. Hier wirke sich die geringe Tarifbindung der Unternehmen in Ostdeutschland spürbar zulasten der Beschäftigen aus, sagte Schulten.
Die Größe der Betriebe wirkt sich ebenfalls aus. Von den Arbeitnehmern in Kleinbetrieben mit weniger als 100 Beschäftigten erhalten laut WSI nur 37 Prozent Urlaubsgeld. In größeren Betrieben mit über 500 Mitarbeitern steigt der Anteil auf 61 Prozent.
Die Höhe des Urlaubsgeldes schwankt stark je nach Branche - zwischen 155 und 2450 Euro in der mittleren Vergütungsgruppe. Am wenigsten Geld für die Urlaubskasse bekommen Beschäftigte in der Landwirtschaft und im Hotel- und Gaststättengewerbe. Über sehr hohe Zahlungen können sich dagegen Arbeitnehmer etwa in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, in der Metallindustrie und im Versicherungsgewerbe freuen. Im Öffentlichen Dienst gibt es kein gesondertes Urlaubsgeld. Es wird mit dem Weihnachtsgeld zu einer einheitlichen Jahressonderzahlung zusammengefasst. Einen gesetzlichen Anspruch auf den Zuschuss für die Urlaubskasse gibt es nicht. Die Sonderzahlungen können vom Arbeitgeber freiwillig geleistet werden oder tariflich vereinbart sein.
In 11 von 22 untersuchten Branchen konnten sich die Beschäftigen zuletzt über eine Erhöhung des Urlaubsgeldes gegenüber dem Vorjahr freuen. Die Anhebungen schwankten laut WSI in den meisten Branchen zwischen 1,0 und 8,7 Prozent. Besonders kräftig fiel die Erhöhung in der chemischen Industrie aus, wo das Urlaubsgeld nahezu verdoppelt wurde.
(Text: dpa)
Arbeitsminister als Putzkraft im Krankenhaus
Kissen und Decken beziehen, Matratzen reinigen, Bettgestelle schieben: Ein Arbeitseinsatz als Putzkraft in einem Krankenhaus hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ins Schwitzen gebracht. Am 23. Mai traf er im Klinikum Bergmannsheil in Bochum auf die Reinigungskraft Susanne Holtkotte (48), der er im Februar während der ARD-Talkshow «Hart aber fair» das Angebot gemacht hatte, jeweils einen Tag den Job des anderen kennen zu lernen. Holtkotte hat Heil bereits einen Tag in Berlin begleitet.

Das Fazit des Ministers nach einem Vormittag Mitanpacken in der Bettenzentrale, wo Holtkotte mit ihrem Team die Betten der Patienten sauber macht: «Was ich heute erlebt habe, bestärkt mich, wirklich noch heftiger zu kämpfen, dass wir eine Grundrente bekommen, die den Namen auch verdient.» Gleichzeitig müsse der Mindestlohn schneller auf zwölf Euro steigen und mehr Branchen müssten sich zu ordentlichen Tarifverträgen verpflichten.
Hart arbeitende Menschen wie Holtkotte müssten mehr Wertschätzung erfahren. «Die halten hier den Laden am Laufen und das Land auch», sagte Heil. Heils bei den Koalitionspartnern CDU und CSU umstrittener Gesetzentwurf zur Grundrente sieht vor, die Bezüge von Menschen mit kleiner Rente nach 35 Beitragsjahren aufzuwerten.
Holtkotte bekommt nach eigener Aussage 10,56 Euro pro Stunde. Bleibt alles, wie es sei, stehe ihr nach dem Arbeitsleben eine Rente von 715 Euro zu. Heil betonte, er werde für die Grundrente kämpfen. (Text: dpa)
Letzte Zigarette - Produktions-Aus in Berlin
Das rückläufige Konsumverhalten bei Zigaretten macht sich in der Tabakindustrie in Deutschland erneut bemerkbar. Die Produktion im Berliner Werk soll voraussichtlich zum 1. Januar 2020 eingestellt werden, wie der Tabakkonzern Philipp Morris am 28. Mai mitteilte. Überkapazitäten werden von Deutschlands Marktführer als Grund genannt. Es ist nicht der erste Standort, dem es so erging.

Seit vielen Jahren ist der Markt in Deutschland rückläufig, obwohl die Zigarette weiterhin das Tabakprodukt Nummer eins ist. Das Statistische Bundesamt listet für 2018 74,36 Milliarden Zigaretten auf, für die von Tabakunternehmen Steuerkennzeichen beantragt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Rückgang von 1,9 Prozent. Anfang der 1990er Jahre waren die Zahlen noch fast doppelt so hoch.
«Die Veränderung des Konsumentenverhaltens erfordert eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten», sagte der Vize-Präsident EU Manufacturing bei Philip Morris International, Mark Johnson-Hill, zu den Plänen für Berlin. «Weil der Absatz von versteuerten Zigaretten in Europa zurückgeht, gibt es erhebliche Überkapazitäten.» Die Nachricht schneite wenige Tage vor dem Weltnichtrauchertag herein.
Nach Unternehmensangaben soll es für etwa 950 der rund 1050 Mitarbeiter in Berlin «faire und sozialverträgliche Lösungen» geben. Philipp Morris ist Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt und hatte bislang Produktion in Berlin und Dresden. Der hiesige Marktanteil lag 2018 demnach bei gut 37 Prozent.
Der sächsische Standort mit gut 300 Jobs soll den Angaben zufolge unangetastet bleiben. Auch Berlin soll nicht geschlossen werden - aber verändert. Rund 75 Jobs sollen verbleiben, weitere 25 Arbeitsplätze nach Dresden und Gräfelfing - Sitz der Verwaltungszentrale der Konzernverbundstochter Philipp Morris GmbH - verlagert werden.
Gewerkschafter sprachen von einem unverantwortlichen Schritt. Das Berliner Werk arbeite hochprofitabel, hieß es von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Damit geht in Berlin eine jahrzehntelange Tradition zu Ende - seit den 1970er Jahren wurden dort laut Philipp Morris Zigaretten produziert. Künftig soll dort weiterhin spezieller Tabak hergestellt werden.
Das Unternehmen betonte, dass weiter von einem Rückgang des Absatzes von versteuerten Zigaretten ausgegangen werde. Deshalb setzt es auch auf diese Karte: Produkte, die als weniger gesundheitsgefährdend beworben werden. Zum Beispiel Tabakerhitzer. Hunderte Jobs seien in Deutschland im Bereich Marketing und Vertrieb entstanden, hieß es.
Vor einiger Zeit erging es der Zigarettenproduktion von British American Tobacco (BAT) am Standort Bayreuth in Bayern ähnlich. Sie wurde nach Unternehmensangaben im Herbst 2018 eingestellt. Grund auch hier: Überkapazität. Der Standort wandelte sich. Nach Firmenangaben verblieb unter anderem die Produktion für Stopftabak und in dem Leerstand wurde eine Logistikzentrale für Westeuropa eingerichtet. Auch BAT setzt verstärkt auf Produkte wie die E-Zigarette.
Der Deutsche Zigarettenverband - er vertritt Mitgliedsunternehmen mit rund 60 Prozent Marktanteil - geht davon aus, dass die bestehenden Standorte in Deutschland erhalten bleiben werden. Die Gesamtzahl beziffert er auf unter zehn Standorte. In der deutschen Tabakindustrie gebe es rund 10 000 Jobs, 2017 habe die Zigarettenindustrie einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Der Verband spricht von einer breiten Herstellerstruktur von großen und mittelständischen Unternehmen, was historisch gewachsen sei. Eine ähnliche Struktur gebe es in Westeuropa kaum noch. Auch der Verband sieht in Produkten wie E-Zigaretten und Tabakerhitzern einen Wachstumsmarkt. Doch zugleich betont Geschäftsführer Jan Mücke: Die Tabakzigarette werde es noch sehr lange geben.
(Text: dpa)
Handwerkspräsident schlägt Ablösesummen für Azubis vor
Berlin (dpa) - Betriebe könnten nach Überlegungen aus dem Handwerk künftig Ablösesummen zahlen, wenn sie Azubis gleich nach der Lehre von der Konkurrenz abwerben. Zwei von drei Fachkräften, die im Handwerk qualifiziert würden, arbeiteten im Laufe ihres Berufslebens in anderen Wirtschaftsbereichen, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur. «Unsere gut ausgebildeten jungen Leute werden abgeworben.» Er denke deshalb über eine Entschädigung für Ausbildungsgebtriebe nach, die Azubis direkt nach der Lehre verlieren.
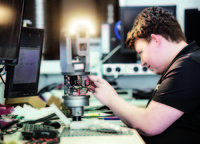
Konkret könnte man regeln, dass Auszubildende in den ersten Jahren nach ihrer Lehre nur dann den Betrieb wechseln dürfen, wenn der neue Arbeitgeber einen Teil der Ausbildungskosten übernimmt, so der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Denn die Betriebe stecken während der dreijährigen Lehre viel Geld in ihre Azubis - oft mit dem Hintergedanken, die jungen Leute später zu übernehmen und dann ohne lange Einarbeitung direkt einsetzen zu können.
Was ein Auszubildender seinen Arbeitgeber kostet, ist je nach Branche unterschiedlich. Insgesamt zahle der Betrieb aber immer drauf, sagte Wollseifer. «Die Ausbildung kostet im ersten und zweiten Jahr Geld - im ersten Jahr viel, im zweiten Jahr etwas weniger. Im dritten Lehrjahr kommt dann auch ein bisschen was rein.»
Nach der aktuellsten Kosten-Nutzen-Rechnung des Bundesinstituts für Berufsbildung (bibb) hat ein Betrieb pro Azubi jährliche Kosten von etwa 18 000 Euro - zugleich aber erwirtschaftet der Lehrling rund 12 500 Euro. Der Betrieb lässt sich einen passgenau ausgebildeten Mitarbeiter bei dreijähriger Ausbildung also mehr als 15 000 Euro kosten.
Einige Branchen müssen derzeit zudem damit rechnen, dass die Ausbildung noch teurer wird. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) plant einen Azubi-Mindestlohn: Alle Auszubildenden sollen vom kommenden Jahr an im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro im Monat verdienen. Im zweiten und dritten Lehrjahr soll es noch mehr geben. Das Handwerk sei von diesen Regelungen besonders betroffen, sagte Wollseifer - «weil wir der stärkste Ausbilder sind». 28 Prozent aller Lehrlinge in Deutschland lernten in Handwerksbetrieben.
Die meisten von ihnen verdienen schon jetzt mehr als den geplanten Mindestlohn - aber längst nicht alle. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bekamen Ende 2017 fast 65 000 Azubis weniger als 400 Euro im Monat, weitere 50 000 unter 500 Euro - zusammen mehr als sieben Prozent aller Auszubildenden. Vor allem ostdeutsche Betriebe müssten mit dem neuen Mindestlohn deutlich mehr in die Ausbildung investieren - zum Beispiel Metzgereien, wo Azubis nach bibb-Daten derzeit nur 310 Euro verdienen. Auch Raumausstatter- und Friseur-Lehrlinge im Osten sowie angehende Schornsteinfeger in ganz Deutschland werden vom geplanten Mindestlohn profitieren.
Den Betrieben werde das Probleme bereiten, sagte Wollseifer. Sie könnten die Mehrkosten auch nicht einfach umlegen, da die Kunden nicht bereit seien, mehr zu zahlen. «Höhere Löhne und Vergütungen für Beschäftigte fordern, ist das eine, aber das andere ist es, dann für die Handwerksleistung auch einen entsprechend wertschätzenden Preis zu zahlen», sagte er.
Studie: Deutschland für ausländische Fachkräfte nur mäßig attraktiv
Berlin (dpa) - Für hoch qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland ist Deutschland keineswegs die erste Adresse. Das zeigt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Demnach belegt Deutschland in der Rangfolge der attraktivsten Standorte für Fachkräfte mit Master-Abschluss oder Doktortitel nur den zwölften Platz. Ganz vorn sehen die Forscher Australien, gefolgt von Schweden und der Schweiz. Die USA landen auf Platz sieben. Schlusslicht unter den 35 Staaten, die verglichen wurden, ist die Türkei.

Untersucht wurden die Qualität der beruflichen Chancen, Einkommen, Steuern, Möglichkeiten für Familienangehörige, Einreise- und Aufenthaltsbedingungen, Zukunftsaussichten, das «Kompetenzumfeld» sowie gesellschaftliche Diversität und Lebensqualität.
«Für Fachkräfte ist die Geschwindigkeit der Visaerteilung ein wichtiger Faktor, aber für viele Hochqualifizierte sind auch die Rahmenbedingungen für Partner und Kinder wichtig», sagt der OECD-Direktor für Arbeit und Soziales, Stefano Scarpetta. Erstellt wurde die Studie mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung.
Der Chef der OECD-Abteilung für Internationale Migration, Jean-Christophe Dumont, erklärt, Deutschland könne durch politische Reformen zwar Boden gut machen. Der Spitzenplatz wäre so aber kurzfristig trotzdem nicht erreichbar. Denn viele Menschen mit sehr guten Englisch- oder Französisch-Kenntnissen würden sich eher nach Australien, Kanada oder Frankreich orientieren.
Aber auch die Schweiz, wo Deutsch die meistverbreitete Sprache ist, schneidet bei der Attraktivität für Fachkräfte deutlich besser ab. Und das liegt nicht nur an höheren Gehältern und niedrigeren Steuern, sondern auch an der «Willkommenskultur», die dort von den Forschern besser eingeschätzt wird. Österreich, wo die in Migrationsfragen sehr restriktive rechtskonservative Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ gerade zerbrochen ist, schneidet bei diesem Indikator nur minimal besser ab als Deutschland - und landet in der Rangfolge insgesamt auf dem 17. Platz.
Die Studie zeigt auch, dass Deutschland als Zielland auf andere Gruppen von potenziellen Migranten durchaus eine große Anziehungskraft ausübt. Auf der OECD-Liste der attraktivsten Standorte für ausländische Studenten belegt Deutschland demnach den dritten Platz, hinter der Schweiz und Norwegen. Daraus abzuleiten, deutsche Universitäten hätten international einen überragenden Ruf, greift allerdings zu kurz. Denn für Studenten spielen auch Faktoren wie niedrige Studiengebühren, vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten und die Möglichkeiten, nach dem Abschluss zu arbeiten, eine Rolle.
Auf Platz sechs liegt Deutschland in der Rangfolge der besten Standorte für Unternehmer. Hier ist Kanada die Nummer eins.
Im Jahr 2017 hatten rund 38 000 Ausländer aus Nicht-EU-Staaten in Deutschland einen Aufenthaltstitel als Fachkraft erhalten. Der Innenausschuss des Bundestages hat für den 3. Juni Sachverständige eingeladen, einen hochumstrittenen Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu beurteilen. Auf dem Tisch liegen auch Alternativ-Modelle der Opposition.
Die Regierung will künftig allen Fachkräften, die über einen Arbeitsvertrag und eine entsprechende Qualifikation verfügen, die Einreise gestatten. Beschränkungen auf sogenannte Engpassberufe sollen wegfallen. Die Arbeitsagentur soll in der Regel auf die «Vorrangprüfung» verzichten, über die bislang erst geklärt werden musste, ob die Stelle nicht auch mit einem Deutschen oder einem EU-Bürger besetzt werden kann. Außerdem wollen Union und SPD nicht-akademischen Fachkräften die Möglichkeit geben, für eine begrenzte Zeit nach Deutschland zu kommen, um sich hierzulande einen Job zu suchen. Das war bisher Akademikern vorbehalten.
Die OECD-Studie zeige, dass Staaten wie Kanada und Australien, die zur Steuerung der Einwanderung auf ein Punktesystem setzen, besser abschnitten als Deutschland, sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel. Er forderte, die Bundesregierung müsse jetzt in den Beratungen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachsteuern, «vom Klein-Klein zum großen Wurf inklusive Punktesystem».
Erstmals betriebsbedingte Kündigungen im Ruhrbergbau
Essen (dpa) - Ein halbes Jahr nach dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland will der Bergbaukonzern RAG erstmals in seiner Geschichte Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Etwa 200 Bergleute sind davon betroffen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag sagte.

Sie hätten alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln. Deshalb bleibe der RAG keine andere Wahl, als Kündigungen auszusprechen. «Wir haben versucht und werden auch bis zuletzt versuchen, alle Kollegen in neue Jobs zu bringen. Aber sie müssen sich auch helfen lassen», sagte der Sprecher. Auch die Gewerkschaft IG BCE hatte die Bergleute aufgefordert, die Jobangebote anzunehmen. Diese auszuschlagen sei «wirklich fahrlässig», sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis.
Linke: Hartz-IV-Familien entgehen jedes Jahr fünf Milliarden Euro
Berlin (dpa) - Hartz-IV-Familien entgehen nach Angaben der Linksfraktion im Bundestag jedes Jahr 5 Milliarden Euro, weil das Kindergeld auf die Hartz-IV-Leistungen angerechnet wird. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die «Passauer Neue Presse» (Donnerstag) hatte zuerst darüber berichtet.

Zwischen 2007 und 2018 seien betroffenen Familien durch die Anrechnung von Kindergeld insgesamt gut 54 Milliarden Euro entgangen. Im vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge 4,8 Milliarden Euro bei rund einer Million betroffenen Familien.
Die Sozialexpertin der Linksfraktion, Sabine Zimmermann, die auch Vorsitzende des Bundestagsfamilienausschusses ist, kritisierte die Familienpolitik der Bundesregierung: Statt gezielt Familien mit geringem Einkommen zu fördern, begünstige diese wohlhabende Familien am stärksten. Zimmermann verweist auf den Kinderfreibetrag, von dem Gutverdiener bei der Steuer profitieren.
«Ausgerechnet die ärmsten Familien aber bekommen keine zusätzliche Leistung, obwohl gerade sie finanzielle Förderung benötigen.» Der Hartz-IV-Kinderregelsatz reiche für die tatsächlichen Bedürfnisse von Kindern «hinten und vorne nicht».
Der Staat überweist Familien für das erste und zweite Kind jeweils 194 Euro Kindergeld pro Monat, 200 für das dritte und 225 für das vierte Kind. Der Antwort des Arbeitsministeriums zufolge wird «verfügbares Einkommen aus Kindergeld bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes als Einkommen berücksichtigt».
Schwache Konjunktur schlägt auf Arbeitsmarkt durch
Nürnberg (dpa) - Die sich eintrübende Konjunktur hat im Mai auf den deutschen Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Erstmals seit fast drei Jahrzehnten verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Monatsvergleich einen leichten Anstieg der Mai-Arbeitslosenzahl - und zwar um 7000 auf 2,236 Millionen. Ein großer Teil dieser Entwicklung gehe allerdings auf das Konto einer Datenkorrektur, betonte BA-Vorstandschef Detlef Scheele.

Noch immer seien im Mai 80 000 Menschen weniger erwerbslos gewesen als vor einem Jahr. Zugleich verzeichnete die Bundesagentur die niedrigste Mai-Arbeitslosigkeit seit 1991. Die Arbeitslosenquote lag in dem Frühlingsmonat unverändert bei 4,9 Prozent. In der Regel sorgt der im Mai meist ausgeprägte Frühjahrsaufschwung für einen besonders starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum April.
«Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich Auswirkungen der zuletzt schwachen Konjunktur. Zudem haben Sondereffekte die aktuellen Arbeitslosenzahlen belastet», kommentierte Scheele die Arbeitsmarkt-Entwicklung im Mai. «Wir sehen im Mai eine besondere Entwicklung, aber keinen Grund für nachhaltige Sorge», ergänzte er.
Für Überraschung sorgte dennoch ein fast nie da gewesener Anstieg der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen von 60 000 im Mai. Nach Scheeles Angaben gehen davon etwa 10 000 auf das Konto der schwachen Konjunktur, rund 40 000 auf Überprüfungen von Jobcenter-Daten auf ihre Plausibilität. Diese waren veranlasst worden, nachdem der Bundesrechnungshof auf falsche Zuordnungen von Hartz-IV-Beziehern gestoßen war. Statt als «arbeitslos» seien mache nur als «arbeitssuchend» geführt worden. Die Folge: Schon die ersten 75 000 Überprüfungen ließen die Arbeitslosenzahl hochschnellen.
Was die Abkühlung der Konjunktur angeht, so wirkt sich diese nach Scheeles Angaben derzeit vor allem bei den von Arbeitsagenturen betreuten Kurzzeitarbeitslosen aus. Ihre Zahl sei entgegen der sonst im Mai üblichen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um knapp 22 000 gestiegen. Dies sei bei schwächerer Konjunktur eine übliche Entwicklung, die sich bereits in den Vormonaten angedeutet habe. Dagegen ging die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher im selben Zeitraum um 101 000 zurück.
Zuversichtlich stimmt Scheele die stabile Entwicklung bei der Beschäftigung. «Die Beschäftigung bleibt weiter auf Wachstumskurs. Aber der Trend wird sich verlangsamen, an Schwung verlieren», prognostiziert der BA-Chef für die kommenden Monate. Trotzdem sieht er keinen Anlass, die von den BA-Arbeitsmarktforschern erarbeite Prognose für den Arbeitsmarkt 2019 zu korrigieren. Das hauseigene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht für dieses Jahr von einem Rückgang der durchschnittlichen Arbeitslosenzahl von 2,199 Millionen aus. Dies wären 141 000 weniger als 2018.
Die Zahl der Erwerbstätigen lag nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im April bei 45,11 Millionen - das war ein Plus von 32 000 im Vergleich zum Vormonat, zum Vorjahr waren es 484 000 Erwerbstätige mehr. Die Zahl der regulären Jobs mit Sozialversicherungspflicht hat nach Hochrechnungen der Bundesagentur von Februar auf März saisonbereinigt um 27 000 zugenommen. Damit hatten 33,31 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job - 646 000 mehr als ein Jahr zuvor.
Einen ganz leichten Rückgang gab es im Jahresvergleich hingegen bei der Zahl der offenen Stellen: Bei der Bundesagentur waren im Mai 792 000 Jobs gemeldet - 1000 weniger als vor einem Jahr. Bereinigt um saisonale Effekte hat sich der Bestand an offenen Stellen um 6000 verringert. Die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die etwa gerade an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,19 Millionen. Sie stieg saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 42 000. Im Vorjahresvergleich ging die Zahl um 94 000 zurück.
Tarifverdienste steigen stärker als die Inflation
Wiesbaden (dpa) - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im ersten Quartal 2019 im Schnitt mehr im Geldbeutel gehabt. Einschließlich Sonderzahlungen wie Leistungsprämien stiegen die Verdienste durchschnittlich um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ohne Sonderzahlungen erhöhten sich die Löhne und Gehälter um 2,7 Prozent. Die Inflation legte dagegen nur um 1,4 Prozent zu.

Unter dem Strich behalten die Beschäftigten somit mehr Geld im Portemonnaie. Das stärkt ihre Kaufkraft und kann den Konsum ankurbeln. Der Privatkonsum ist aktuell die verlässlichste Stütze der deutschen Konjunktur. Dank der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und gestiegener Einkommen sind die Menschen nach Angaben der GfK-Konsumforscher unverändert in Kauflaune.
Der Anstieg der Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen fiel zum Jahresanfang in den einzelnen Branchen allerdings unterschiedlich stark aus. Das größte Plus gab es im Baugewerbe mit 4,4 Prozent sowie im Bereich Verkehr und Lagerei (4,3 Prozent). Mit einem deutlich geringeren Zuwachs mussten sich Beschäftigte im Bereich Erziehung und Unterricht (1,4 Prozent) sowie in der Öffentlichen Verwaltung (1,9 Prozent) begnügen. Das lag den Angaben zufolge aber vor allem daran, dass die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst der Länder frühestens ab Mai rückwirkend zum Januar ausgezahlt wird.