Gewerkschaften kündigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst an
Bürgerinnen und Bürger müssen sich in den kommenden Tagen auf bundesweite Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder einstellen. Betroffen sind Schulen, Unikliniken, Polizei oder Justizverwaltung. Das kündigten die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb am Freitag (3. November) in Potsdam nach der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder an, die nach ihren Angaben ergebnislos verlaufen ist.

«Die Arbeitgeber haben auch in der zweiten Runde kein Angebot vorgelegt und alle wesentlichen Forderungen und Erwartungen rundweg abgelehnt», sagte Verdi-Chef Frank Werneke im Anschluss an die Gespräche. «Die Arbeitgeber verschließen die Augen vor dem massiven Personalmangel im öffentlichen Dienst der Länder, der Belastungssituation der Beschäftigten und der unzureichenden Bezahlung. Wir werden die Warnstreiks deshalb in der Zeit vor der nächsten Runde massiv ausweiten.»
Einen genauen Zeitpunkt für Streiks nannten die Gewerkschaften nicht. «Die Streik-Taktiken werden jetzt in den Bezirken, in den Ländern diskutiert und auf den Weg gebracht», sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach. «Wir werden den Druck auf der Straße jetzt erhöhen müssen, damit die Arbeitgeber eben sehen, wie ernst die Situation der Beschäftigten in den Ländern ist.»
Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Die Tariflaufzeit soll 12 Monate betragen. Für Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften eine monatliche Stadtstaatenzulage von 300 Euro. Die Forderungen knüpfen damit an den Tarifabschluss vom April dieses Jahres für den Bund und die Kommunen an. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rief ihre Mitglieder zu Protestaktionen auf. «Die Beschäftigten werden in den nächsten Wochen in den Betrieben und auf der Straße mit Streiks und Aktionen die richtige Antwort auf diesen Konfrontationskurs der TdL geben», sagte Vorsitzende Maike Finnern. Die Inflation sei noch nicht vorbei. Die Beschäftigten hätten aus den vergangenen beiden Jahren einen großen Nachholbedarf beim Gehalt. «Lehrkräfte und Sozialarbeiter an den Schulen sind wegen des Fachkräftemangels am Limit», sagte Finnern.
Besonders weit auseinander liegen die Tarifparteien laut Verdi bei dem Tarifschutz für studentisch Beschäftigte. «Hier verweigern die Länder die Herstellung von Tarifschutz», sagte Werneke. «Wir sind auch vollkommen auseinander bei der Frage, ob die besondere Situation der Beschäftigten in Stadtstaaten berücksichtigt werden muss. Hier lehnen die Länder eine besondere Regelung für die Beschäftigten deutlich ab.»
Während die Gewerkschaften vehement hinter ihren Forderungen stehen, zweifelt die Gegenseite an der Umsetzung. «Wir hatten sehr intensive, aber angesichts der Rahmenbedingungen sehr schwierige Gespräche», sagte TdL-Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). «Denn in der Tat, wir befinden uns in einer sehr schwierigen haushälterischen Situation.» Am Montag (6. November) finde eine Ministerpräsidentenkonferenz statt. Diese müsse die Weichen stellen für viele Fragen der Länderfinanzen. Er sei aber trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen optimistisch, dass es bis Weihnachten zu einer Einigung kommen könne. «Mein Fazit fällt nicht ganz so negativ aus, wie das des Kollegen Werneke», sagte Dressel.
Ein Durchbruch könnte in der dritten Verhandlungsrunde ab dem 7. Dezember erreicht werden. Bei den Verhandlungen geht es um die Gehälter für rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Verhandelt wird etwa für Lehrkräfte an Schulen, Lehrende an Hochschulen sowie Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken. Strafvollzug und Justizwesen sind genauso betroffen wie die Kitas in Berlin. Hessen ist außen vor, da das Land nicht in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ist, mit der Verdi und der Beamtenbund dbb am Tisch sitzen.
(Text: dpa)
Volkswagen verhängt Einstellungsstopp
Volkswagen verhängt im Ringen um Milliarden-Einsparungen einen vorläufigen Einstellungsstopp für die wichtigsten Standorte. «Aufgrund der laufenden Effizienzprogramme in der Volkswagen AG werden externe Einstellungen temporär begrenzt und keine externen Stellen ausgeschrieben», sagte ein Sprecher am gestrigen Freitag (3. November) auf Anfrage in Wolfsburg. Betroffen seien alle sechs Standorte in Niedersachsen und Hessen: Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel. Zuvor hatte «Business Insider» berichtet.

Hintergrund ist das geplante Effizienzprogramm, über das die Kernmarke Volkswagen seit Anfang Oktober mit dem Betriebsrat verhandelt. Die Marke hat mit hohen Kosten und Produktionsausfällen zu kämpfen. In den ersten neun Monaten 2023 sank die operative Umsatzrendite auf 3,4 Prozent. Damit blieben von 100 Euro Umsatz nur rund 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft übrig. Das im Sommer angekündigte «Performance Programm» soll die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro senken und die Rendite auf 6,5 Prozent erhöhen.
Der VW-Betriebsrat zeigte Verständnis für den nun verhängten Einstellungsstopp. «Angesichts der jüngsten Effizienzbemühungen ist es nachvollziehbar, dass das Unternehmen nunmehr den weiteren Stellenaufbau durch Neueinstellungen noch stärker auf das Nötigste zurückfährt», sagte ein Sprecher. «Wir sehen darin die Chance, zukünftig noch konzentrierter als bisher das Schlüsselthema der internen Transformation voranzutreiben.»
Wie lange der Einstellungsstopp gelten soll, ließ VW zunächst offen. Die Maßnahme gelte «bis auf weiteres», so der Konzernsprecher. Nicht betroffen seien bereits laufende Einstellungsverfahren, betonte der Konzernsprecher. Daneben gebe es auch Ausnahmen für zwingend erforderliche Aufgaben, etwa zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. Erst im Oktober hatte VW einen Bericht zurückgewiesen, dass im Rahmen des Effizienzprogramms in der Verwaltung bis zu 4000 Stellen wegfallen sollen.
(Text: dpa)
Höhere Durchschnittslöhne in der Pflege
Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen werden künftig durchschnittlich mit mindestens 20,77 Euro pro Stunde entlohnt. Wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) mitteilte, gelten seit diesem Mittwoch (1. November) entsprechende neue Richtwerte für die Bezahlung. Es handele sich das zweite Jahr in Folge um einen Anstieg um etwa zwei Prozent.

Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung haben demnach zukünftig Anspruch auf im Schnitt mindestens 17,53 Euro pro Stunde, drei Prozent mehr als 2022. Hilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung erhalten 19,53 Euro (+ 2,5). Pflegefachkräfte müssen mit mindestens 23,75 Euro pro Stunde entlohnt werden (+ 1,6).
Hintergrund ist eine seit September 2022 geltende gesetzliche Regelung, nach der nur noch Einrichtungen mit der Pflegeversicherung abrechnen dürfen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen oder sich bei der Bezahlung am üblichen Niveau im jeweiligen Bundesland orientieren.
Ein entsprechendes Durchschnittslohnniveau wird auf Basis der in den Regionen vereinbarten Tarifverträge errechnet und veröffentlicht. Nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen - sogenannte Durchschnittsanwender - hätten nun zwei Monate Zeit, die Höhe ihrer Vergütungen entsprechend anzupassen, hieß es vom GKV-Spitzenverband. Die Regelung zur besseren Bezahlung soll einem Arbeitskräftemangel in der Pflege entgegenwirken.
Der durchschnittliche Lohn in den Bundesländern unterscheidet sich. So liegt das «regional übliche Entlohnungsniveau», wie es bezeichnet wird, in der Pflege zwischen 19,58 Euro pro Stunde in Mecklenburg-Vorpommern und 21,30 Euro in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
(Text: dpa)
Kaum Herbstbelebung - 2,607 Millionen Menschen ohne Job
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober gegenüber dem September saisonbedingt um 20 000 auf 2,607 Millionen zurückgegangen. Das sind 165 000 Arbeitslose mehr als im Oktober vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am gestrigen Donnerstag (2. November) in Nürnberg mit.

Die Arbeitslosenquote lag im Oktober unverändert zum September bei 5,7 Prozent. Die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fiel damit vergleichsweise gering aus - im vergangenen Jahr hatte es im gleichen Zeitraum einen Rückgang um 43 000 Arbeitslose gegeben. Stichtag für die Erhebung der Oktoberzahlen war der 12. Oktober.
«Seit gut einem Jahr tritt die deutsche Wirtschaft mehr oder weniger auf der Stelle», sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles. «Nach so langer Zeit bleibt das nicht ohne sichtbare Folgen für den Arbeitsmarkt. Angesichts der Wirtschaftsdaten behauptet er sich aber vergleichsweise gut», sagte Nahles.
Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Im Oktober waren 749 000 freie Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet, 98 000 weniger als vor einem Jahr.
Mit Blick auf den Lehrstellenmarkt mahnte Nahles mehr Kompromissbereitschaft sowohl bei den jungen Leuten auf Bewerberseite als auch bei den Ausbildungsbetrieben an. Es sei schwerer geworden, Bewerber um und Anbieter von Lehrstellen zusammenzubringen.
Von Oktober 2022 bis September 2023 wurden den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern insgesamt 545 000 Berufsausbildungsstellen gemeldet - in etwa genauso viele wie im Vorjahr. Auch die Zahl der Bewerber blieb mit 422 000 weitgehend stabil. Der seit Jahren spürbare Rückgang der Bewerberzahlen sei in diesem Jahr zum Halten gekommen, teilte die Bundesagentur mit. Dennoch kommen auch in diesem Jahr auf 100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen rechnerisch nur 80 Bewerberinnen und Bewerber, eine ähnliche Quote wie im Vorjahr.
(Text: dpa)
Donnerstag für gute Kitas
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft seit Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 zu wöchentlichen Mahnwachen für die Kitas auf. Unter dem Motto „Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftigte gefährdet!“ werden bis Weihnachten in vielen Bundesländern vor den Staatskanzleien, bei den Senaten oder Ministerien und vor Bundesministerien oder dem Kanzleramt regelmäßig Mahnwachen durchgeführt.

„Die Personaldecke in den Kitas ist inzwischen so dünn, dass weder für Eltern noch für die Kinder ein verlässliches Angebot stattfinden kann. Die Kolleginnen und Kollegen sind froh, wenn Kinder und Beschäftigte den Tag heil überleben. Das kann so nicht weitergehen und das werden die Kita-Beschäftigten jetzt mit ihren Mahnwachen deutlich machen“, erklärt die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle.
Seit einigen Jahren erleben die Beschäftigten der Kitas einen ständig wachsenden Fachkräftemangel. Auch die offiziellen Berechnungen zeigen, dass die Fachkräftelücke stetig steigt. Die Agentur für Arbeit spricht inzwischen von einem Engpassberuf. Bei diesen Zahlen sind die Bedarfe für einen Ausbau des Systems oder die Anhebung der Qualität noch nicht eingerechnet.
Dieser Fachkräftemangel trifft auf Kitas, die ohnehin schon mit Personalschlüsseln ausgestattet sind, die nicht kindgerecht seien. Laut Auskunft der Fachkräfte im ver.di Kita-Personalcheck, fehlten im Sommer 2021 im Durchschnitt drei Fachkräfte, um in den Kitas fachlich angemessen arbeiten zu können, insgesamt mindestens 172.782 Fachkräfte. Und das beim aktuellen Ausbaustand der Kindertageseinrichtungen.
Gleichzeitig besteht bei den Eltern ein enormer Kita-Platzbedarf, in den westdeutschen Ländern fehlen 362.400 und in Ostdeutschland 21.200 Kita-Plätze - nach Berechnungen von Bertelsmann -, um die Wünsche der Eltern zu erfüllen.
Kommunen und Länder reagieren auf diese Nachfrage mit dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der Schaffung neuer Plätze. Wenn neue Einrichtungen eröffnen, wird das Personal aus den umliegenden Kitas in der Region abgezogen. Damit wird die Personaldecke in allen Kitas immer dünner und der Personalmangel wächst stetig. Die Kita-Beschäftigten erkranken häufiger, fallen aufgrund von Burnout lange Zeiten aus oder verlassen das Arbeitsfeld Kita.
Laut einer Studie der DAK sind 97 Prozent der Beschäftigten in den Kitas vom Personalmangel betroffen. Der DAK gegenüber begründen die Beschäftigten diese Situation damit, dass es allgemein zu wenig Mitarbeiter und ungewöhnlich viele Personalausfälle gibt. Dort wo Personalmangel erlebt wird, sind die Personalausfälle besonders hoch. Das heißt auch die Personalausfälle durch Erkrankungen steigen und inzwischen ist laut DAK keine andere Berufsgruppe häufiger wegen Erkrankungen des Atmungssystems oder aufgrund psychischer Erkrankungen arbeitsunfähig.
Für die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen bedeutet dies, dass sie ihrem Arbeitsauftrag, der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern nicht mehr nachkommen können.
„Wenn das Kita-System nicht total vor die Wand fahren soll, muss dieser Teufelskreis sofort durchbrochen werden. Wir müssen uns auf die Stabilisierung des derzeitigen Kita-Systems konzentrieren. Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Fachkräftelücke von Tag zu Tag wächst“, betont Behle.
Schon jetzt sei keine Verlässlichkeit für die Eltern mehr gegeben. Notgruppen, Reduzierung der Öffnungszeiten oder auch Schließungen von Gruppen seien an der Tagesordnung.
„Es muss von Seiten der Politik endlich die Verantwortung übernommen werden. Wir erwarten, dass von höchster politischer Ebene ein Kita-Gipfel veranstaltet wird, auf dem zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Stabilisierung des Kita-Systems, ein Stufenplan für den quantitativen und qualitativen Ausbau und der damit verbundene notwendige Aufbau des Fachpersonals aufeinander abgestimmt und Finanzen entsprechend bereitgestellt werden“, fordert die ver.di-Vize. Auch die Eltern dürften in dieser schwierigen Situation nicht allein gelassen werden. Sie benötigten dringend Unterstützung, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder verlässlich möglich wird.
(Text: ver.di)
Lufthansa will mit neuem Flugbetrieb Löhne drücken
Im Lufthansa-Konzern zeichnet sich tarifpolitischer Ärger um die neue Tochter City Airlines ab, die Zubringerflüge nach Frankfurt und München erledigen soll. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fürchtet ein schnelles Ende der bestehenden Tochter Lufthansa Cityline, welche diese Verbindungen bislang fliegt.

In laufenden Tarifgesprächen für den neuen Flugbetrieb verlange das Unternehmen bei einem Wechsel «erhebliche Zugeständnisse hinsichtlich Vergütung, Arbeitszeiten, Einsatzbedingungen, Freizeitanspruch, Dienstplangestaltung und -stabilität», berichtete Ufo-Verhandlungsführer Joachim Vázquez Bürger am 26. Oktober laut Mitteilung. Das werde die Gewerkschaft nicht akzeptieren.
Der Konzern hatte am 25. Oktober den Start von City Airlines für den Sommer angekündigt und will im November mit Neueinstellungen beginnen. Zunächst sollen Eurowings-Flugzeuge vom Typ Airbus A319 eingesetzt werden, von denen bis zum Jahresende 2024 nach dpa-Informationen mindestens vier oder fünf im Betrieb sein sollen.
Lufthansa prüft zudem die Einsatzmöglichkeiten für bis zu 40 Airbus A220 oder Embraer E2, die neubestellt werden müssten. Ufo rechnet damit, dass diese Flugzeuge sämtlich bei City Airlines eingesetzt werden sollen.
Parallel verhandelt auch die Vereinigung Cockpit über Bedingungen der Piloten in dem neuen Flugbetrieb. Für die Kunden ändert sich bei der Buchung nichts, weil die Tickets weiter ausschließlich über die Lufthansa verkauft werden.
(Text: dpa)
Laumann für höheren Mindestlohn
Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat sich für ein neues Mindestlohn-Modell ausgesprochen, mit dem nach derzeitigem Stand mehr Geld auf dem Konto von Arbeitern im Niedriglohnsektor landen würde.

«Warum nehmen wir nicht einfach das, was die EU-Richtlinie auch vorschlägt, nämlich eine doppelte Grenze: Die Lohnuntergrenze soll nicht unter 60 Prozent des Medianlohns und nicht unter 50 Prozent des Durchschnittslohns der jeweiligen Länder liegen», sagte der CDU-Politiker der «Rheinischen Post» (Samstag).
Ende 2024 würde man mit diesem Modell demnach voraussichtlich bei etwa 14 Euro liegen - das wäre mehr als nach dem aktuell gültigen Stand, bei dem der Mindestlohn in den kommenden zwei Jahren um 82 Cent auf 12,82 Euro je Stunde erhöht wird. Der Mindestlohn müsse außerdem regelmäßiger angepasst werden, forderte Laumann. Bei den aktuellen Preiserhöhungen und der Inflation gehe es nicht, dass das nur alle zwei Jahre passiere.
Die Mindestlohnkommission hatte im Juni die Erhöhung auf 12,82 Euro in zwei Schritten vorgeschlagen. Die Arbeitnehmervertreter in der Kommission bewerteten die Anhebung als zu niedrig, wurden aber überstimmt. Die Kommission ist besetzt mit jeweils drei Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern, zwei Wissenschaftlern und einer oder einem Vorsitzenden.
Laumann sagte: «Die Mindestlohnkommission ist doch eine Katastrophe.» Die vergangene Erhöhung sei «ein Witz» gewesen. Nachdem die Gewerkschaften dort zuletzt mithilfe der unparteiischen Vorsitzenden überstimmt worden seien, sei die Kommission ohnehin am Ende. «Ich denke nicht, dass die Gewerkschaften sich im Interesse der von ihnen vertretenen Beschäftigten weiter an dem Prozess der Mindestlohnfindung unter solchen Vorgaben beteiligen wollen», sagte Laumann.
(Text: dpa)
Büroangestellte gehen an drei Tagen pro Woche zur Arbeit
Fünf Tage in der Woche im Büro - mit dem Homeoffice ist das für die meisten Bürobeschäftigten vorbei. Unterschiede gibt es je nach Branche. Die Pendelzeit spielt bei der Anwesenheit eine überraschend kleine Rolle.

Bürobeschäftigte, die eine volle Arbeitswoche im Unternehmen verbringen, sind einer Umfrage zufolge in der Minderheit. Inmitten des Homeoffice-Trends kamen zuletzt in den sieben Bürohochburgen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart Büroangestellte im Schnitt 3,2 Tage in der Woche zur Arbeit, zeigt eine Umfrage des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL). Das entspricht einer Quote von rund 63 Prozent bei einer Fünf-Tage-Woche.
Vor den ersten Corona-Lockdowns im März 2020 habe die Anwesenheit im Büro im Mittel bei vier Tagen gelegen, hieß es in der repräsentativen Umfrage unter 1540 Menschen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Fünf-Tage-Woche im Büro in den sieben Metropolen werde lediglich von etwa einem Drittel der Beschäftigten praktiziert (2020: 55 Prozent). An der Umfrage im Juli und August nahmen sowohl Büroangestellte als auch Beschäftigte von Industrieunternehmen teil, die im Büro arbeiten.
IT-Angestellte arbeiten öfters zuhause: Zwischen den Branchen gibt es große Unterschiede. Demnach ist die Rückkehr ins Büro in Marketing, Kultur und Medien recht stark ausgeprägt: Dort wurde 86 Prozent des Anwesenheitsniveaus vom März 2020 erreicht - ähnlich wie im öffentlichen Dienst, in Erziehung und Gesundheit sowie im Bau-, Grundstücks- und Wohnungswesen. In der Branche IT und Telekommunikation lag die Rate hingegen bei 53 Prozent.
Während Vorschriften eine große Rolle für die Büronutzung spielten, hätten die Lage des Büros und die Entfernung zum Wohnort wenig Einfluss, teilte JLL mit. Nur in Berlin und Frankfurt liegt demnach die Rückkehrquote bei Bürobeschäftigten, die im Umland wohnen, deutlich unter der von Angestellten aus der Stadt. Sonst waren die Werte ähnlich. «Das bedeutet, dass der Effekt der Pendelzeiten für die Entscheidung des Arbeitsorts weniger ausschlaggebend ist als häufig angenommen», sagte JLL-Experte-Helge Scheunemann.
Dafür gibt es andere wichtige Faktoren für die Anwesenheit. «Je mehr Beschäftigte und je internationaler das Unternehmen, desto weniger wird im Büro gearbeitet», heißt es in der JLL-Umfrage.
Firmen verkleinern Büroflächen: Seit der Pandemie hat sich das Homeoffice fest im Arbeitsleben etabliert - auch wenn einige Firmen ihre Beschäftigten nun wieder zu mehr Büroarbeit verpflichten. Mit dem Trend sind Büroimmobilien unter Druck geraten. Im zweiten Quartal gab es laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken einen Preiseinbruch um fast zehn Prozent.
Nach einer jüngst veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts will eines von elf Unternehmen Büroflächen als Reaktion auf die vermehrte Heimarbeit verkleinern. Viele Firmen hätten schon reagiert. Andere planten das in den kommenden Jahren, wenn die oft langfristigen Mietverträge ausliefen. Jedoch ist Homeoffice längst nicht in allen Branchen verbreitet. Nur knapp die Hälfte aller Stellen in Deutschland ist laut Ifo überhaupt mit der Arbeit zu Hause vereinbar.
(Text: dpa)
Chipkrise macht deutschen Unternehmen schwer zu schaffen
Die weltweite Chipkrise macht den Unternehmen in Deutschland immer noch schwer zu schaffen - für viele Firmen sieht die Lage sogar noch bedrohlicher aus als vor zwei Jahren. Obwohl es in bestimmten Bereichen der Halbleiterbranche - etwa bei Speicherchips - schon wieder ein Überangebot gibt, klagten die meisten Firmen in Deutschland in einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom über große Herausforderungen bei der Chip-Versorgung.
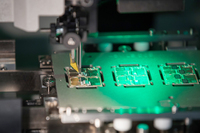
Die Folge für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Manche Produkte wie kleinere Elektroautos werden derzeit von den Herstellern kaum angeboten, weil die verfügbaren Chip-Kontingente in größere und teurere Modelle gesteckt werden. Außerdem reichen die Firmen die höheren Beschaffungskosten für die Chips an die Endkunden weiter.
In der Bitkom-Umfrage berichteten 89 Prozent der Unternehmen hierzulande, die in diesem Jahr Halbleiter gekauft haben, von Schwierigkeiten bei der Beschaffung. Das sind noch einmal 8 Prozentpunkte mehr als 2021, als 81 Prozent von entsprechenden Problemen berichteten. Besserung ist für viele Firmen nicht in Sicht: Gut zwei Drittel (68 Prozent) dieser Unternehmen rechnen damit, dass die Lieferverzögerungen 2024 zunehmen werden. 41 Prozent gehen sogar von einer deutlichen Zunahme aus.
Für die Studie befragte das Institut Bitkom Research im August die Verantwortlichen in 404 Unternehmen in Deutschland aus verarbeitendem Gewerbe und ITK-Dienstleistungen ab 20 Beschäftigten. Darunter befanden sich 346 Unternehmen, die Halbleiter verwenden. Die telefonische Gesamtumfrage ist nach Angaben des Bitkom repräsentativ. Die statistische Fehlerspanne beträgt plus/minus fünf Prozent in der Gesamtstichprobe.
Beim Einkauf der Halbleiter auf dem Weltmarkt stoßen die Unternehmen aus Deutschland auf mehrere Probleme: 97 Prozent der betroffenen Unternehmen berichten von Lieferverzögerungen, 93 Prozent sind mit Preiserhöhungen konfrontiert. Häufig sind die benötigten Chips aber auch gar nicht aufzutreiben: 89 Prozent sagten, dass zumindest bestimmte Bauteile teilweise nicht verfügbar waren. Und oft kommt auch nicht die bestellte Menge an: Bei 88 Prozent wurden die Liefermengen reduziert.
Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst setzte sich am gestrigen Dienstag (24. Oktober) dafür ein, die Abhängigkeit insbesondere von asiatischen Herstellern zu verringern. Ohne Chips gehe in der deutschen Wirtschaft nichts. «Halbleiter sind die Basistechnologie der digitalen Wirtschaft.» Der Verbandsvertreter begrüßte die mit staatlichen Subventionen geförderte Ansiedlung von Fabriken großer Chiphersteller wie Intel und TSMC in Deutschland. «Wir stehen hier in einem weltweit massiven Wettbewerb mit anderen Standorten, beispielsweise den USA und vielen Ländern Südostasiens.»
Der Aufbau eines gesamten Ökosystems der Chipindustrie - von der Forschung über das Chipdesign bis hin zu Produktion - werde nicht zu Nulltarif zu bekommen sein. «Dafür muss man etwas bezahlen, damit der Halbleiterstandort Deutschland wächst», sagte der Bitkom-Präsident.
Die weltweite Chipkrise hängt eng mit der Corona-Pandemie zusammen. Vor allem Lockdowns in chinesischen Chipfabriken führten zu Produktionsausfällen. Verschärft wurde die Krise durch Naturkatastrophen wie Erdbeben in Asien und den großflächigen Stromausfall in Texas im Februar 2021, durch die auch wichtige Chipfabriken in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Gleichzeitig zog in der Pandemie die Nachfrage nach Elektronikprodukten deutlich an, da viele Menschen von zu Hause aus arbeiteten und mehr Freizeit im Internet verbrachten. Dies führte zu einem verstärkten Bedarf an Chips für Laptops, Tablets, Smartphones und anderen Geräten.
Vor zwei Jahren - auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie - betrug die durchschnittliche Lieferverzögerung bei Halbleiter-Bauteilen beziehungsweise Komponenten in Deutschland 6,5 Monate. Dieser Wert ist nur leicht gesunken. Aktuell müssen die Firmen durchschnittlich rund 5 Monate lang auf die bestellte Ware warten.
Die Unternehmen versuchen unterdessen, sich gegen die Lieferengpässe zu wappnen. 61 Prozent haben inzwischen langfristige Vereinbarungen mit ihren Chip-Lieferanten verhandelt. Jede zweite Firma (52 Prozent) hat sich auf die Suche nach alternativen Anbietern gemacht. Mehr als ein Drittel der Hersteller haben das Design ihrer Produkte geändert, um nicht länger auf knappe Spezial-Chips angewiesen zu sein. So hat beispielsweise das Berliner Unternehmen AVM etliche Modelle seines populären Internet-Routers «Fritzbox» ohne Unterstützung von ISDN-Telefonen auf den Markt gebracht, weil die dafür notwendigen Spezialchips schwer aufzutreiben waren. Erst der Chipmangel hatte AVM dazu bewegt, das Ende des ISDN-Zeitalters einzuläuten.
(Text: Christoph Dernbach, dpa)
Frau für die Zukunft - Benner ist erste IG-Metall-Chefin
Christiane Benner ist schon oft vorangegangen. Als erste Frau ist die 55-Jährige am gestrigen Montag (23. Oktober) zur Chefin der IG Metall gewählt worden - Deutschlands größte, mächtigste und männlichste Gewerkschaft, fest verankert in der Automobilindustrie und mit einem Frauenanteil von knapp rund 20 Prozent. Jahrzehntelang wurde die Organisation geführt von machtbewussten Männern wie Franz Steinkühler, Berthold Huber oder zuletzt Jörg Hofmann, der mit 67 Jahren nicht erneut antrat.

Nun also Christiane Benner, bereits seit acht Jahren Hofmanns Stellvertreterin. Von den Delegierten in Frankfurt wurde sie mit einem enormen Vertrauensvorschuss von 96,4 Prozent Zustimmung ausgestattet. Ein höheres Ergebnis hatte zuletzt Gewerkschaftslegende Otto Brenner im Jahr 1965 erreicht mit 98,8 Prozent. Im Vergleich zu ihrem Vorergebnis aus dem Jahr 2019 legte Benner knappe zehn Prozentpunkte zu.
Benner ist sich ihrer Verantwortung in schwierigen Zeiten bewusst und stellt sich der Mega-Aufgabe der Transformation ganzer Wirtschaftszweige: «Unsere Industrie in Deutschland muss weiter entwickelt werden und nicht abgewickelt», rief sie den begeisterten Metallern zu. Die Bedürfnisse der Beschäftigten im Umbau will sie besser sichtbar machen und ist sich sicher: «Das Potenzial für einen erfolgreichen Umbau im Land ist da.»
Seit ihrem Gewerkschaftseintritt im Jahr 1988 hat die einstige Jugendvertreterin eines Metallbetriebs im südhessischen Darmstadt die IG Metall aus vielen Perspektiven kennengelernt - und dabei eine bemerkenswerte Vorliebe für schwierige und zukunftsträchtige Themen entwickelt. Nach einem von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Soziologie-Studium sowie Stationen in Frankfurt und Hannover wurde sie 2008 Bereichsleiterin beim Vorstand, zuständig unter anderem für IT-Kräfte und «Zielgruppenarbeit».
Diese Gruppen waren unter anderem Frauen, Angestellte, Studenten und Ingenieure und damit recht weit entfernt von der prägenden Gruppe der klassischen Facharbeiter. Benner hat bereits scheinselbstständige Click-Worker organisiert sowie über Kreislaufwirtschaft und künstliche Intelligenz nachgedacht, als das für andere noch weit entfernte Zukunftsmusik war. Sie sagt über sich selbst: «Ich habe die Informationstechnologie immer als Treiber begriffen. Wenn ich verstehe, was bei IBM oder SAP geschieht, dann weiß ich, was in den anderen Betrieben drei oder vier Jahre später passiert.»
Aus der nach eigener Einschätzung «leicht nerdigen» Frau für komplexe Zukunftsfragen wurde recht schnell eine Frau mit Zukunft, die 2011 in den Vorstand berufen wurde und 2015 zur Zweiten Vorsitzenden avancierte. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt trat die verheiratete Benner als Teil, aber auch als eindeutige Anführerin eines fünfköpfigen Kandidaten-Teams für den Vorstand an.
Den Wahlerfolg hat die Sozialdemokratin auch der eigenen Standfestigkeit zu verdanken, als sie sich im vergangenen Jahr nicht an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wegloben ließ und lieber der IG-BCE-Funktionärin Yasmin Fahimi den Vortritt ließ. Danach scheiterte noch der Versuch baden-württembergischer Seilschaften, in einer neuartigen Doppelspitze neben ihr den Stuttgarter Bezirkschef Roman Zitzelsberger als Co-Vorsitzenden zu installieren. Fahimi gehörte in Frankfurt zu den ersten Gratulanten.
Sie sei in ihrem Leben immer bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen, sagt die groß gewachsene und sportliche Ex-Handballerin Benner, die bevorzugt am Main joggt. «Ich war auch Schulsprecherin, das hat meine Mutter damals gar nicht so recht mitbekommen.» Der Posten an der Gewerkschaftsspitze bedeutet nach den Usancen der IG Metall demnächst auch den Wechsel in den Aufsichtsrat von VW, dem sich die neue Chefin nicht verschließen wird. «Es gibt eine Erwartungshaltung und es gibt eine Tradition. Und der werde ich selbstverständlich entsprechen.»
In der starken Auto-Fraktion ihres Hauses sieht sich die langjährige BMW- und Continental-Aufseherin bestens vernetzt. Die IG Metall sei aber weit vielfältiger, macht Tarife für Kfz-Mechatroniker ebenso wie für die Textil- und Holzwirtschaft und hat mit dem Maschinenbau und der Metallverarbeitung weitere Schlüsselindustrien in ihrem Organisationsbereich.
Benner ist eine entschiedene Verfechterin der Frauenquote und will in der Arbeitswelt die strukturellen Nachteile abbauen, die dazu führen, dass Frauen nach der Babypause nicht mehr auf den Karrierezug gelassen werden. Eine «kurze Vollzeit» von 32 Stunden für Männer und Frauen gleichermaßen scheint ihr ein richtiges Mittel gegen den Fachkräftemangel zu sein. Diese Forderung nach einer weiteren Arbeitszeitverkürzung, die auf eine Vier-Tage-Woche hinauslaufen könnte, will sie aber zunächst auf die Stahlindustrie beschränkt sehen, die vor einem ökologischen Umbau steht.
Manchmal rutscht der Soziologin noch ein Anglizismus wie «empowern» (befähigen) durch, doch grundsätzlich ist Benner um klare Ansprache nicht verlegen. «Ich muss die Dinge einfach so erklären, dass das ein ganz normaler Mensch auf dem Hallenboden versteht - und kein überkandideltes Zeug.» Ihre Organisation mit gut 2,1 Millionen Mitgliedern will sie künftig deutlich sichtbarer machen, in herkömmlichen wie in den sozialen Medien viel präsenter sein. Ihre Vorgänger bevorzugten eher das politische Hinterzimmer statt das grelle Licht der Talkshows, doch Benner sagt: «Ich scheue überhaupt nicht das Licht der Öffentlichkeit.» Seit Montag ist es endgültig so weit.
(Text: Christian Ebner, dpa)