Gewerkschaft fordert einheitliche Polizeizulage von 300 Euro
Die sogenannte Polizeizulage sollte nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Zukunft bundesweit einheitlich gezahlt werden. Aktuell sei hier eine «zunehmende Zerfaserung» zu beobachten, kritisierte die Gewerkschaft.

Da an Polizisten und Polizistinnen aber die gleichen Anforderungen gestellt würden, egal ob sie in Flensburg, Görlitz oder Aachen beschäftigt seien, müsse diese Ungerechtigkeit beseitigt werden. Die GdP sprach sich für eine bundeseinheitlich gleiche Besoldung aus und bekräftigte ihre Forderung nach einer Polizeizulage in Höhe von 300 Euro für alle anspruchsberechtigten Beamten.
Die Polizeizulage dient als Anerkennung für Belastungen, denen Polizeibeamte ausgesetzt sind. Hierzu zählen Schichtdienst, Bereitschaftsdienst, Gefahr für Leib und Leben sowie psychische Belastungen.
Während die Zulage in Niedersachsen nach einer Dienstzeit von zwei Jahren aktuell 180 Euro beträgt, werden in Nordrhein-Westfalen rund 130 Euro pro Monat gezahlt. In Brandenburg erhalten die Anspruchsberechtigten nach dem zweiten Dienstjahr rund 127 Euro Polizeizulage, in Bayern sind es rund 168 Euro im Monat. Für die Beschäftigten bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt liegt der entsprechende Betrag bei 228 Euro. Die Zulage erhalten auch Beamte der Zollverwaltung, die in bestimmten Bereichen - etwa in der Grenzabfertigung - eingesetzt sind.
Die politischen Entscheider in Bund und Ländern sollten hier rasch «auf einen gemeinsamen, hohen Nenner» kommen, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke. Das gelte auch für die Frage, ob die Zulage für die Höhe der Pensionsansprüche relevant sei oder nicht. Aktuell beschränke sich die sogenannte Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage lediglich auf Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein.
Für die Anspruchsberechtigten im Bund hatte das Bundeskabinett Mitte Juli entschieden, die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder einzuführen. Die Ruhegehaltsfähigkeit von Stellenzulagen war mit dem Versorgungsreformgesetz von 1998 grundsätzlich aufgehoben worden.
(Text: dpa)
Fachkräfte-Offensive für neue Chipfabriken notwendig
Für die geplanten neuen Chipfabriken in Deutschland ist aus Sicht des Verbands Bitkom neben der staatlichen Finanzhilfe auch eine Fachkräfte-Offensive notwendig.
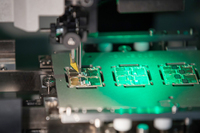
«Wenn wir die neuen Chipfabriken mit Milliardenbeträgen aus Steuergeldern fördern, dann brauchen wir auch finanzielle Mittel für die Ausbildung von Fachkräften, die dort arbeiten sollen, ganz gleich, ob vom Bund oder von den Ländern», sagte der Präsident des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, Ralf Wintergerst, dem «Münchner Merkur» (18. September). Bundesweit seien in der Informationstechnik 137 000 Stellen offen.
Chiphersteller planen mit staatlicher Milliardenhilfe Halbleiterwerke in Magdeburg und Dresden. Es sei von immenser Bedeutung, dass die neuen Standorte ihren Betrieb wie geplant aufnehmen könnten, sagte Wintergerst. 90 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland seien auf Halbleiter angewiesen, für 80 Prozent seien sie unverzichtbar.
Der Bitkom-Präsident sprach sich dafür aus, dass qualifizierte Fachkräfte einfacher nach Deutschland einwandern können; sie könnten sich ihre Jobs weltweit aussuchen. Die Verwaltungsprozesse seien noch «so umständlich, dass sie den politischen Willen, Top-Leute nach Deutschland zu holen, faktisch konterkarieren», kritisierte Wintergerst. Außerdem müssten in Deutschland mehr junge Menschen an Schulen und Hochschulen für die Digitalwirtschaft und Mikroelektronik begeistert werden, besonders Mädchen und junge Frauen.
(Text: dpa)
Handelsverband empfiehlt Erhöhungen vor Tarifabschluss
Im festgefahrenen Tarifkonflikt im Einzelhandel empfiehlt der Branchenverband HDE den Unternehmen, die Entgelte für die Beschäftigten vorerst auch ohne Tarifabschluss zu erhöhen. Es sei nicht abzusehen, dass die Tarifverhandlungen zeitnah zu einer Lösung gebracht würden, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am gestrigen Montag (18. September) in Berlin mit.

Nach einem Beschluss des tarifpolitischen HDE-Ausschusses bestehe für tarifgebundene Unternehmen deshalb nun die Möglichkeit, frühestens ab dem 1. Oktober «freiwillige anrechenbare Vorweganhebungen in Höhe von 5,3 Prozent auszuzahlen», hieß es. «Unternehmen können diese Vorweganhebung, die sowohl die tariflichen Löhne, Gehälter und Auszubildendenvergütungen umfasst, ab Oktober 2023 in allen Tarifgebieten des Einzelhandels umsetzen.»
In Abhängigkeit der eigenen wirtschaftlichen Situation müsse jedes Unternehmen selbst entscheiden, ob es die Empfehlung des Verbandes umsetzen könne, teilte der HDE weiter mit. «Es gibt keinerlei Verpflichtung für die Unternehmen, diese exakt und in voller Höhe umzusetzen. Sie ist nur bezüglich Ihrer Obergrenze verpflichtend.» An einer Lösung im Tarifkonflikt halte der Verband fest.
Seit Monaten ringen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber im Einzelhandel auf Länderebene bundesweit um einen neuen Tarifabschluss. Verdi fordert eine Erhöhung der Stundensätze um einheitlich 2,50 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber hatten je nach Bundesland unterschiedliche Angebote unterbreitet.
(Text: dpa)
Beschäftigte bei Coca-Cola Deutschland erhalten mehr Geld
Die rund 6500 Beschäftigten des Getränkeherstellers Coca-Cola Deutschland bekommen mehr Geld. Die Gewerkschaft NGG und Coca-Cola Europacific Partners Deutschland einigten sich in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss mit einer Laufzeit von 20 Monaten, wie das Unternehmen am gestrigen Freitag (15. September) mitteilte.

Demnach erhalten die Beschäftigten in zwei Schritten monatlich 350 Euro mehr Geld. Vom 1. März 2024 steige das Bruttomonatsgehalt um 180 Euro, vom 1. Januar 2025 an um weitere 170 Euro.
«Zusammen mit der Gewerkschaft haben wir ein faires, umfassendes Tarifpaket abgeschlossen», erklärte Coca-Cola-Verhandlungsführer und Arbeitsdirektor Gero Ludwig. Das Unternehmen erkenne die Leistung der Beschäftigten an und habe deshalb in Zeiten höherer Inflation eine klare Entgelterhöhung vereinbart. «Gleichzeitig können wir jetzt noch flexibler und schneller auf eine höhere oder veränderte Nachfrage reagieren, indem wir unsere Produktionskapazitäten ausweiten.»
24-Stunden-Betrieb möglich: Mit dem Abschluss kann der Betrieb nach Unternehmensangaben in Abstimmung mit den Betriebsräten auf 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche ausgeweitet werden. Dazu würden nun Regelungen für die Abfüllung von Dosen und kleinen Einwegpfandflaschen an den Standorten Hildesheim, Knetzgau, Mannheim, Halle, Dorsten und Karlsruhe verlängert und um weitere PET-Einweg- und Mehrweg-Glas-Linien unter anderem in Dorsten und Lüneburg erweitert. Ziel sei, möglichst viel Ware in Deutschland zu produzieren und so auf Importe oder Auftragsabfüllung zu verzichten.
Auszubildende erhalten den Angaben zufolge vom 1. Januar 2024 an 100 Euro mehr im Monat und noch einmal 100 Euro vom 1. Januar 2025 an. Außerdem gebe es eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 1000 Euro, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt werde. Coca-Cola Europacific Partners Deutschland ist mit einem Absatz von mehr als 3,9 Milliarden Litern (2022) nach eigenen Angaben das größte deutsche Getränkeunternehmen.
(Text: dpa)
Sorge vor Jobabbau bei VW in Zwickau
Angesichts mauer Nachfrage nach Elektro-Autos droht bei Volkswagen ein Stellenabbau im Zwickauer Werk. Nach dpa-Informationen ist im Gespräch, befristete Verträge von Mitarbeitern nicht zu verlängern. Zunächst könnte das Ende Oktober einige Hundert der insgesamt etwa 10 700 Beschäftigten an dem sächsischen Standort treffen.

Dort arbeiten derzeit mehr als 2000 Menschen mit befristeten Verträgen. Abhängig von der weiteren Marktlage könnte ihnen nun auf absehbare Zeit das Ende ihrer Jobs bei VW bevorstehen.
«Es ist eine ernste Situation», sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch auf Anfrage. Er sei seit mehreren Wochen in Kontakt mit dem Betriebsrat und seinem niedersächsischen Amtskollegen Olaf Lies (SPD). Er räumte ein, dass es zurzeit Probleme an den Absatzmärkten gebe. Dieser Trend dürfe sich nicht verstärken. Es gelte, Wege zu suchen, um Kaufinteressenten stärker zu deutschen Anbietern zu bringen. Eine Idee sei eine Leasing-Initiative sächsischer Unternehmen. Dulig: «Aber VW ist auch selbst gefragt, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Absatzsituation verbessert und stabilisiert werden kann.»
Schon seit Wochen wächst in der E-Auto-Fabrik die Verunsicherung angesichts schleppender Nachfrage. Viele Mitarbeiter äußern sich besorgt. Nun haben sich Vertrauensleute der IG Metall mit einem Brief an die Geschäftsführung gewandt. «Es reicht! Wir wollen endlich Antworten», zitierte die «Freie Presse» am Mittwoch aus dem Schreiben. Fragen werden laut danach, warum die E-Autos nicht besser beworben werden und ob das Werk ein 3-Schicht-Standort bleibt.
VW hat sein Werk in Zwickau in den vergangenen Jahren für 1,2 Milliarden Euro zur reinen Fabrik für Elektrofahrzeuge umgebaut. Der letzte Verbrenner lief dort 2020 vom Band. Produziert werden neben ID-Modellen auch Fahrzeuge der Marken Audi und Cupra. Voriges Jahr wurden nach früheren Angaben 218 000 E-Autos gebaut. Dieses Jahr sollte die Produktion eigentlich steigen - bis zu 360 000 Fahrzeuge wären bei Vollauslastung möglich. Stattdessen könnte es nun zur Reduzierung von Schichten kommen.
Doch angesichts hoher Inflation und rückläufiger Förderprämien sind Autokäufer bei Elektroautos inzwischen zurückhaltend. So erwarten Branchenexperten, dass der Marktanteil von E-Autos bei Neuzulassungen in Deutschland im kommenden Jahr stark zurückgehen wird. E-Autos sind im Schnitt deutlich teurer als Verbrenner. Hinzu kommt, dass zum 1. September die staatliche Kaufprämie für Gewerbekunden weggefallen ist, für Privatkunden sinkt sie zum Jahreswechsel von maximal 6750 auf 4500 Euro. Außerdem gibt es für die deutschen Hersteller auf den internationalen Märkten wachsende Konkurrenz in diesem Sektor: Nicht nur durch Tesla, sondern auch chinesische Hersteller wie BYD.
(Text: dpa)
Schärfere Sanktionen bei Ablehnung von Arbeit?
Unionsfraktionsvize Jens Spahn will schärfere finanzielle Sanktionen für Bürgergeldbezieher, die eine Arbeitstätigkeit ablehnen. Der CDU-Politiker sagte am Montag (11. September) in Berlin: «Wer arbeiten kann, sollte arbeiten.» Es sei eine Debatte nötig über die Frage, welche Folgen es für Menschen habe, die eine angebotene Arbeit nicht annehmen.

Ihm gehe es nicht um diejenigen, die nicht arbeiten könnten - wegen Krankheit, Behinderung oder einer schwierigen Lebensphase. Für diejenigen solle es eine angemessene, vernünftige Unterstützung geben.
Es gehe um 24-, 28-, 33-jährige «gesunde, fitte junge Menschen» - bei ihnen habe er die Erwartung, dass ein Angebot für eine Qualifikation oder eine Arbeit angenommen werde, so Spahn. Wenn sie nicht angenommen werde, sollte dies auch stärkere finanzielle Konsequenzen haben als bisher - zumal in einer Zeit, in der es zigtausende offene Arbeitsstellen gebe.
Die Union wolle dieses Thema in den nächsten Monaten stärker in die Diskussion bringen. Spahn sprach erneut von einem «Pakt für Leistung und Fleiß». Er nannte eine Belastungsgrenze bei den Sozialabgaben, Steuerfreiheit bei Überstunden und eine Reform beim Bürgergeld.
Spahn hatte die geplante Anhebung des Bürgergeldes bereits kritisiert. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte angekündigt, dass das Bürgergeld im nächsten Jahr um rund zwölf Prozent erhöht werden solle.
(Text: dpa)
Covestro nimmt Verhandlungen über Übernahme durch Ölkonzern Adnoc auf
Der Chemiekonzern Covestro zeigt sich nach wochenlangen Spekulationen offen für eine Übernahme durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Der Covestro-Vorstand beschloss mit Blick auf das von Adnoc bekundete Interesse die Aufnahme ergebnisoffener Gespräche, wie der Dax-Konzern am Freitagabend ( 8. September) mitteilte.

Damit können die beiden Unternehmen nun über Details einer möglichen Akquisition reden. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht.
Wie hoch ein Angebot ausfallen müsste, um auf Zustimmung von Covestro zu treffen, bleibt offen. «Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen», betonten die Leverkusener.
Spekulationen über ein Interesse von Adnoc gibt es seit Mitte Juni, damals hatten die Aktien noch um die 40 Euro gekostet. Das Management um Covestro-Chef Markus Steilemann hatte seither aber jeglichen konkreten Kommentar vermieden und betont, solche Spekulationen würden nicht kommentiert. Vielmehr haben beide Seiten dem Vernehmen nach bisher nicht direkt miteinander gesprochen, sondern lediglich informell über Investmentbanken und Anwälte kommuniziert.
Die Covestro-Aktien kosteten zuletzt auf der Handelsplattform Tradegate 52,78 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinne von knapp acht Prozent auf 51,50 Euro aus dem Xetra-Hauptgeschäft aus. Bereits am Nachmittag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Covestro sich noch in dieser Woche offiziell offen für Gespräche zeigen dürfte. Der Aktienkurs war daraufhin hochgeschnellt.
Adnoc baut seit einiger Zeit sein Engagement rund um das Chemiegeschäft aus. Der Konzern fördert fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate. Er hat Investitionspläne in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar (140 Mrd. Euro), um sein Geschäft mit Erdgas, Chemikalien und sauberer Energie weltweit zu erweitern.
Denn die Ölproduzenten am Persischen Golf wollen ihr bisher auf den Verkauf von Rohöl, Benzin und Diesel konzentriertes Geschäft auf eine breitere Basis stellen. Außerdem versucht Adnoc so, seine Position in der Konkurrenz mit dem Ölkonzern Saudi Aramco zu verbessern. Im vergangenen Jahr hatte Adnoc bereits Anteile am österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV erworben.
IG BCE pocht auf Beschäftigungs-Sicherung: Die Gewerkschaft IG BCE pocht bei den Gesprächen des Chemiekonzerns Covestro über eine mögliche Übernahme durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) auf Beschäftigungssicherung.
«Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung», sagte ein IGBCE-Sprecher der «Rheinischen Post» (Montag). Covestro mit einem Konzernumsatz von 18 Milliarden Euro (2022) beschäftigt weltweit 18 000 Mitarbeiter, mehr als 7800 davon arbeiten in Deutschland.
(Texte: dpa)
Vodafone-Tochter startet milliardenschweren Glasfaser-Ausbau
Mit großem Rückstand zu Wettbewerbern hat nun auch der Internetanbieter Vodafone seinen Glasfaser-Ausbau verstärkt. Ab sofort verlegen Bagger im nordrhein-westfälischen Neuss Glasfaser, um dort bis 2024 «Fiber to the Home» (FTTH) an gut 28 000 Haushalten und Firmen verfügbar zu machen, teilte Vodafone am gestrigen Montag (11. September) in Düsseldorf mit.

Es geht um die Firma OXG, die Vodafone und einer Luxemburger Finanzholding gehört. Das neue Unternehmen, das derzeit 100 Beschäftigte hat und künftig 500 haben soll, will Glasfaser an bis zu sieben Millionen Haushalten verlegen. Bis zu sieben Milliarden Euro liegen für den Ausbau bereit.
In den kommenden Wochen sollen Bauarbeiten in Düsseldorf und Duisburg sowie in den hessischen Städten Marburg und Kassel starten, bis Ende 2024 sollen die Bagger in bis zu 150 Städten und Gemeinden gebuddelt haben. «Das verleiht dem Glasfaser-Ausbau hierzulande einen kräftigen Schub», sagte Vodafone-Deutschlandchef Philippe Rogge.
Vodafone Deutschland hat bisher nur im kleinen Stil Glasfaser bis in Wohnungen verlegt, stattdessen setzte die Düsseldorfer Firma auf Fernsehkabel für die Internet-Übertragung. Diese Technologie ist allerdings schwankungsanfälliger als FTTH, also Glasfaser bis in die Wohnung. FTTH gilt als das bestmögliche Internet, ist für Endkonsumenten aber auch teurer als Fernsehkabel-Internet (Koaxialkabel) oder die sehr schwankungsanfälligen und relativ langsamen Übertragungen über Kupferkabel-Telefonleitungen (VDSL).
Vodafone geriet angesichts der Glasfaser-Anstrengungen der Konkurrenz in den vergangenen Jahren unter Druck. Um den teuren Ausbau zu stemmen, holte sich Vodafone die Luxemburger Finanzholding an Bord. Allianzen mit kapitalstarken Partnern aus anderen Branchen sind üblich: 2021 gründete Telefónica ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Versicherungskonzern Allianz bekannt, um binnen sechs Jahren bis zu fünf Milliarden Euro in Glasfaser zu investieren. Am meisten Tempo macht die Deutsche Telekom, die seit 2020 stark auf Glasfaser setzt und FTTH schon an 6,4 Millionen Haushalten verfügbar gemacht hat. Das kostete Milliarden.
Viele Bewohner verzichten aber angesichts der relativ teuren Verträge noch darauf, das Highspeed-Internet zu nutzen. Das dürfte sich in den kommenden Jahren ändern, da das Internet im Alltag der Menschen immer wichtiger wird.
(Text: dpa)
IG Metall will 32-Stunden-Woche bei gleichem Lohn
In der nächsten Tarifrunde der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie fordert die IG Metall eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich sowie 8,5 Prozent mehr Geld. Dies hat die Tarifkommission der Gewerkschaft am Mittwoch (6. September) in Duisburg beschlossen.

«Diese Arbeitszeitverkürzung wäre der Einstieg in die 4-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird», sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler laut Mitteilung. Die 8,5 Prozent-Forderung begründete er mit der hohen Inflationsrate. Die erste Verhandlungsrunde ist für Mitte November geplant. Die Friedenspflicht endet Ende November. In der Branche sind laut IG Metall rund 68 000 Menschen beschäftigt.
Die Arbeitgeber wiesen die Forderungen umgehend zurück. Viele Unternehmen benötigten während der Transformation zusätzliche, hochqualifizierte Arbeitskräfte zum Einfahren der neuen Anlagen zur klimaneutralen Stahlproduktion, teilte der Arbeitgeberverband Stahl mit. Dies sei angesichts des gravierenden Fachkräftemangels in der gesamten Wirtschaft herausfordernd genug. «Eine pauschale Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden hingegen entzieht den Unternehmen diese dringend benötigte zusätzliche Arbeitskraft.»
Eine Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich führe zu einer Erhöhung der Stundenlöhne um 8,6 Prozent. Zusammen mit der Lohnforderung von 8,5 Prozent ergebe sich ein Gesamtvolumen von 17,1 Prozent. Dies überfordere die Leistungsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie und gefährde sie existenziell.
Die IG Metall betonte, dass die Stahlindustrie aufgrund der Transformation zu grünem Stahl vor großen Herausforderungen stehe. Nach einer Übergangsphase werde es in einigen Jahren zu einem «Druck auf Beschäftigung» kommen. «Dann braucht es ein Instrument, damit Beschäftigte ihren Arbeitsplatz behalten können», so Giesler. Eine Arbeitszeitverkürzung spiele dabei eine herausragende Rolle: «Die vorhandene Arbeit wird auf mehr Schultern verteilt und sichert Beschäftigung.»
Die Arbeitszeitverkürzung führe auch zu einer Win-Win Situation für Beschäftigte und Unternehmen. So wirke eine Arbeitszeitverkürzung bei den Beschäftigten stressreduzierend. Für Unternehmen bedeute dies weniger Krankheitsausfälle und eine höhere Produktivität.
(Text: dpa)
Trotz Tarifsteigerungen sind Reallöhne weiter gesunken
Die höheren Tarifabschlüsse im ersten Halbjahr 2023 haben nach Berechnung der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung die Inflation nicht vollständig ausgleichen können. Erst mit Hilfe der häufig vereinbarten Einmalzahlungen von bis zu 3000 Euro hätten viele Tarifbranchen zur Reallohnsicherung beigetragen, erklärte Tarif-Experte Thorsten Schulten am gestrigen Donnerstag (7. September) laut einer Mitteilung.

Gleichzeitig warnte er vor einem Basiseffekt: «Da es sich um Einmalzahlungen handelt, wirken sie sich mit ihrem Auslaufen in den Folgejahren jedoch stark dämpfend auf die Lohnentwicklung aus.»
Ohne die steuer- und abgabenfrei gestellten Einmalzahlungen seien die Reallöhne im ersten Halbjahr um durchschnittlich 1,7 Prozent gesunken, berichtete das WSI-Tarifarchiv der Stiftung. Die nominale Steigerung von 5,6 Prozent bei den Tariflöhnen habe die Teuerung von 7,4 Prozent nicht ausgleichen können. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Tarifsteigerungen deutlich höher ausgefallen, was unter anderem auf Abschlüsse bei der Deutschen Post AG und im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen zurückzuführen sei. Insgesamt gilt für etwa die Hälfte der rund 34 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland ein Tarifvertrag.
Für das zweite Halbjahr rechnet Schulten aber mit einem starken Rückgang der Inflation, so dass eine deutlich positivere Tarifbilanz zu erwarten sei. «Angesichts der sich deutlich eintrübenden Konjunkturaussichten darf es zu keinem weiteren Einbruch beim privaten Konsum kommen», meinte der Gewerkschafter mit Blick auf die Lohnverhandlungen unter anderem im Handel und im Öffentlichen Dienst der Länder. Es sei «besonders wichtig», dass die Tariflohndynamik weiter anhalte und Kaufkraftverluste möglichst vermieden würden.
(Text: dpa)