Bahn und EVG treffen sich zu dreitägigen Tarifgesprächen in Fulda
Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn ging es am gestrigen Dienstag (23. Mai) in Fulda in die nächste Verhandlungsrunde. Drei Tage lang bis einschließlich Donnerstag wollen der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dort über höhere Tarife für rund 180 000 Konzernbeschäftigte sprechen. Sollten sie weiterhin keine Lösung finden, drohen erneute Warnstreiks oder gar eine Urabstimmung der EVG über unbefristete Streiks.

Zuletzt war Bewegung in den über Monate festgefahrenen Tarifstreit gekommen: Beide Seiten räumten unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt den Knackpunkt Mindestlohn aus dem Weg. Rund 2000 Beschäftigte hatten den gesetzlichen Mindestlohn bislang nur über Zulagen erhalten. Die Bahn hat zugestimmt, diesen rückwirkend zum März als Sockel in die Tariftabellen aufzunehmen. So können sich künftige Tarifergebnisse auf diese höhere Basis beziehen. Nach dem Vergleich sagte die EVG einen geplanten 50-stündigen Warnstreik vergangene Woche kurzfristig ab.
In Fulda soll es nun in die Verhandlungen über die konkreten Tarifforderungen gehen. Die Gewerkschaft will mindestens 650 Euro mehr oder zwölf Prozent für die oberen Einkommen, außerdem eine Laufzeit von zwölf Monaten.
Die Bahn hat bislang eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie sowie eine stufenweise Tariferhöhung von insgesamt zehn Prozent für die unteren und mittleren Einkommen sowie acht Prozent für die höheren angeboten. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten würde die erste Stufe davon aber erst im nächsten Jahr kommen. Die EVG fordert eine Tabellenerhöhung aber noch 2023.
Die Gewerkschaft verhandelt außer mit der Bahn mit Dutzenden weiteren Eisenbahn-Unternehmen über die gleichen Forderungen. Schon zwei Mal hat sie mit bundesweiten Warnstreiks den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht. Ein Abschluss beim bundeseigenen Konzern dürfte die Richtung auch für die Verhandlungen bei den anderen Betrieben vorgeben. Warnstreiks wären dort weiter möglich, solange nicht überall ein Kompromiss erreicht ist. Sie hätten allerdings deutlich geringere Auswirkungen als bei der Deutschen Bahn.
Die EVG ist die größere von zwei Gewerkschaften beim bundeseigenen Konzern. Die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter ihrem Chef Claus Weselsky sind erst für den Herbst angesetzt. Schon Anfang Juni will die GDL aber ihre Forderungen festlegen.
(Text: dpa)
Handwerk fehlen fast 40 000 Auszubildende
Das Handwerk in Deutschland hat mit einem erheblichen Mangel an Lehrlingen zu kämpfen. «Ende April waren bei unseren Handwerkskammern noch knapp 40 000 offene Ausbildungsplätze gemeldet», sagte Handwerkspräsident Jörg Dittrich der «Rheinischen Post».

Es sei schwierig für die Betriebe, genügend Bewerberinnen und Bewerber zu finden. «Besonders groß ist der Bedarf bei den Klimaberufen, also etwa bei Heizung-Sanitär-Klima, bei Elektroinstallateuren, generell am Bau, aber auch in den Lebensmittel- oder in den handwerklichen Gesundheitsberufen.»
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz könne nur einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten, sagte Dittrich. «Wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, die inländischen Fachkräfte-Potenziale zu heben. Mehr Frauen müssen die Möglichkeit der Arbeit in Vollzeit bekommen. Dafür müssen wir mehr tun für die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern.»
Zu viele junge Menschen brächen die Schule ohne Abschluss ab und an Gymnasien sei es «immer noch so, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem eine Studienberatung erhalten und die Perspektiven beruflicher Bildung gar nicht vorkommen», kritisierte der ZDH-Präsident. Laut Mikrozensus gebe es derzeit rund 600 000 Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die zwar die Schule verlassen hätten, aber danach nicht in einer Arbeitsstelle angekommen oder eine Ausbildung beziehungsweise ein Studium begonnen hätten. «Wo sind die geblieben? Hier muss die Politik dringend mehr hinschauen», forderte Dittrich.
(Text: dpa)
Unhaltbare Bedingungen für Saisonarbeitskräfte
Saisonarbeitskräfte im Spargelanbau in Deutschland sind laut der Entwicklungsorganisation Oxfam teilweise mit «unhaltbaren» Arbeitsbedingungen konfrontiert. «Löhne werden systematisch gedrückt, viele Arbeiter sind mit einer kaum durchschaubaren Kombination aus Stunden- und Akkordlöhnen konfrontiert und berichten von schwer oder gar nicht erreichbaren Zielvorgaben», sagte eine Oxfam-Sprecherin. Zuvor hatte der RBB über eine Oxfam-Studie zu dem Thema berichtet.

«Das sind keine Einzelfälle», sagte Benjamin Luig von der Initiative Faire Landarbeit, die an der Studie mit beteiligt war. Beschäftigte klagten regelmäßig über falsche Angaben bei der Arbeitszeiterfassung, wodurch sie mehr arbeiten müssten, aber nicht mehr bezahlt bekämen. Lohndumping und massiver Leistungsdruck dürften kein Geschäftsmodell sein, so Luig.
Hinzu kommt laut der Oxfam-Sprecherin das Problem hoher Lohnabzüge durch überhöhte Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte. «Für eine Baracke ohne Küche verlangt einer der Betriebe 40 Euro pro Quadratmeter. Die durchschnittliche Kaltmiete in der Münchner Innenstadt liegt bei 23 Euro», erklärte Steffen Vogel, Oxfam-Referent für globale Lieferketten und Menschenrechte im Agrarsektor. Einen Betrieb in Brandenburg bezeichnete Oxfam als «skandalös». Die Unterkünfte glichen Baracken, in den Zimmern wachse Schimmel.
Die Verantwortung für diese unhaltbaren Arbeitsbedingungen sieht Oxfam auch bei den deutschen Supermärkten, die für Spargel «ruinös niedrige Preise» zahlten. «Den Preisdruck geben die Betriebe nach unten weiter: an die Arbeiter auf den Feldern», sagte ein Oxfam-Referent. Oxfam fordert deshalb, dass der Einkauf unter Produktionskosten verboten wird. Laut dem RBB-Bericht prüft das Bundesarbeitsministerium, ob die Vorfälle systematischer Natur sind und gegebenenfalls eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen erforderlich ist.
Grundlage der Oxfam-Studie sind nach eigenen Angaben eigene Recherchen und ein Bericht des PECO-Instituts, für den Arbeiter bei vier Betrieben interviewt wurden.
(Text: dpa)
Umfrage: Zufriedenheit und Motivation von Arbeitnehmern nimmt ab
Die Zufriedenheit und Motivation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland ist einer Studie zufolge zurückgegangen. Insgesamt zufrieden waren laut der Umfrage aus dem März, die im Auftrag der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) durchgeführt wurde, 83 Prozent der Befragten. 2021 hatten das noch 90 Prozent der befragten Arbeitnehmer angegeben.

Der Anteil derer, die uneingeschränkt zufrieden mit ihrem Job sind, nahm demnach deutlich ab. Von einer knappen Hälfte (49 Prozent) im Jahr 2021 auf 31 Prozent in diesem Jahr. Einen Anstieg von zehn auf 17 Prozent verzeichnete hingegen der Anteil derer, die mit ihrem Job eher oder komplett unzufrieden sind.
Motiviert bei der Arbeit waren laut der Umfrage 71 Prozent der Beschäftigten. Vor zwei Jahren hatte der Anteil noch bei 78 Prozent gelegen. Der Anteil der hoch motivierten Arbeitnehmer sank von 28 Prozent auf 17 Prozent. Auf die Frage, was die Beschäftigten bei der Arbeit am meisten motiviere, nannten die Befragten mit jeweils 58 Prozent am häufigsten ein gutes Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen sowie ein gutes Arbeitsklima. Ein hohes Gehalt stand nur bei jedem Dritten hoch in Kurs, Erfolgsprämien wurden nur von zwölf Prozent der Befragten angegeben.
Eine niedrige Motivation gehe zulasten der Produktivität der Unternehmen, sagte EY-Geschäftsführungsmitglied und Arbeitsdirektor Jan-Rainer Hinz laut Mitteilung. Die Gründe für mangelnde Zufriedenheit und Motivation könnten vielfältig sein, die Folgen seien jedoch immer die gleichen. «Durch das nicht genutzte Potenzial verlieren Unternehmen Milliarden», sagte Hinz.
Der «Faktor Mensch» dürfe laut Hinz nicht unterschätzt werden. Geld allein mache offenbar nicht glücklich. Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sowie Freundschaften spielten offenbar eine sehr große Rolle. «Unternehmenslenker müssen daher noch stärker als bisher ein Gefühl für die veränderten Bedürfnisse ihrer Angestellten entwickeln», sagte Hinz. (dpa
Nach Treffen: Bahn und EVG planen mit dreitägigen Verhandlungen
Nach einem vertraulichen Treffen an diesem Mittwoch zeichnet sich im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn eine lange Verhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda ab. Die Verhandlungen «beginnen am Dienstag und sind bis einschließlich Donnerstag angesetzt», teilten Bahn und die Gewerkschaft EVG am Mittwoch übereinstimmend mit. Bislang waren die Gespräche lediglich für zwei Tage angesetzt. Es ist die vorerst letzte terminierte Tarifrunde im laufenden Konflikt.

Beide Seiten hatten sich bereits an diesem Mittwoch zu einem Gespräch getroffen. Dieses «diente der Vorbereitung der in der nächsten Woche in Fulda stattfindenden Tarifverhandlungen», hieß es. Über den genauen Ort des Treffens und konkrete Inhalte wurde zunächst nichts bekannt.
Die EVG will in ihren Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahn-Unternehmen unter anderem 650 Euro mehr pro Monat oder 12 Prozent bei den oberen Einkommen durchsetzen, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Bahn hat bislang neben einer Inflationsausgleichsprämie prozentuale Steigerungen von insgesamt 10 Prozent bei den unteren und mittleren sowie 8 Prozent bei den oberen Einkommen in Aussicht gestellt. Bei der Laufzeit sieht der Konzern 27 Monate vor.
Bei einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am vergangenen Wochenende konnten die Tarifparteien einen Knackpunkt beim Thema Mindestlohn weitgehend aus dem Weg räumen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte daraufhin einen angekündigten 50-Stunden-Warnstreik kurzfristig abgesagt. (dpa)
Streikgefahr an Flughäfen sinkt - Tarifabschluss für Luftsicherheit
An den deutschen Flughäfen ist die Gefahr neuer Streiks für dieses Jahr gesunken. Nach dem Öffentlichen Dienst wurde nun auch für die rund 25 000 Beschäftigten an den Luftsicherheitskontrollen ein Tarifabschluss vereinbart. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi und des Arbeitgeberverbandes BDLS vom Mittwoch wurden insbesondere höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit sowie neuartige Zulagen für Führungskräfte vereinbart.

Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper bedauerte, dass es zu keiner Einigung auf höhere Zuschläge bei Mehrarbeit gekommen sei. Das wäre angesichts der bevorstehenden Reisewelle das richtige Signal gewesen, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen, erklärte er laut einer Mitteilung.
Gehaltssteigerungen waren in den Verhandlungen, die in diesem Frühjahr auch von mehreren Warnstreiks begleitet worden waren, kein Thema. Hier läuft der entsprechende Vertrag beiden Seiten zufolge zum Jahresende aus, so dass dann erneute Verhandlungen aufgenommen werden. Dann will Verdi auch wieder höhere Mehrarbeitszuschläge fordern. (dpa)
Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland steigt langsamer
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt steigt die Zahl der Erwerbstätigen langsamer. 45,6 Millionen Erwerbstätige im ersten Quartal 2023 bedeuteten einen saisonüblichen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Im Vergleich zum Startquartal des vergangenen Jahres ergab sich hingegen ein Plus von 446 000 Personen oder 1,0 Prozent. Damit hat sich in der Jahressicht der Beschäftigungszuwachs zwar fortgesetzt, aber nach 1,1 Prozent im Vorquartal etwas abgeschwächt.

Erneut wurden vor allem im Dienstleistungsbereich neue Jobs geschaffen. Den größten absoluten Beschäftigungsgewinn verzeichnete der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 123 000 Personen (+1,2 Prozent). Es folgte der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit einem Plus von 106 000 Personen (+0,9 Prozent). Weniger Beschäftigung gab es bei sonstigen Dienstleistern sowie in der Finanz- und Versicherungsbranche. Erneut ging die Zahl der Selbstständigen innerhalb der Erwerbstätigen zurück. (dpa)
Peek & Cloppenburg Düsseldorf plant Abbau von 350 Arbeitsplätzen
Der angeschlagene Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) will im Rahmen seiner Sanierungsbemühungen rund 350 der über 1500 Arbeitsplätze in der Düsseldorfer Zentrale abbauen. «Um unser Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu bringen, sind die Neuaufstellung der Organisation und eine deutliche Reduzierung der Kosten erforderlich», begründete Geschäftsführer Steffen Schüller am 12. Mai den Schritt.
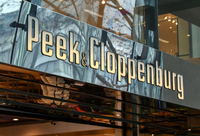
Das Traditionsunternehmen hatte im März angesichts tiefroter Zahlen Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Bei der auf Sanierung ausgerichteten Insolvenzvariante übernimmt ein gerichtlich bestellter Sachwalter die Aufsicht über die Rettung. Die Unternehmensführung behält die Kontrolle, wird aber von einem externen Sanierungsexperten beraten. Nicht vom Schutzschirmverfahren betroffen ist das von P&C Düsseldorf unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg Hamburg.
Viele der 350 betroffenen Arbeitsplätze könnten mithilfe von Eigenkündigungen, Befristungsabläufen und Probezeitkündigungen abgebaut werden, betonte das Unternehmen. Der überwiegende Teil der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalte das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln.
Die rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 67 Verkaufshäusern in Deutschland sind nach Unternehmensangaben von dem Stellenabbau nicht betroffen. Die Modehäuser sollen P&C zufolge zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells bleiben. «Unser stationärer Fußabdruck soll weiter wachsen, und wir eröffnen demnächst neue Stores in Bonn und Berlin», sagte P&C-Geschäftsführer Thomas Freude.
Allerdings will das Unternehmen auch in den Filialen künftig schärfer auf die Kosten gucken. «Es ist wichtiger denn je, dass wir jedes Verkaufshaus kostendeckend betreiben», sagte Restrukturierungsgeschäftsführer Dirk Andres. Die Profitabilität der einzelnen Standorte werde deshalb intensiv beobachtet. Das Unternehmen sei in Gesprächen mit den Vermietern, um angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen marktgerechte Konditionen zu verhandeln. «An einigen Standorten erweisen sich die Gespräche jedoch als bisher nicht zufriedenstellend», sagte Andres.
Ziel des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben, die Insolvenzverfahren der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sowie der Einkaufsgesellschaft Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG bis spätestens Ende des Jahres abzuschließen.
(Text: dpa)
Tarifkonflikt zwischen IG Metall und Vestas eskaliert abermals
Der seit einem Jahr schwelende Konflikt zwischen der IG Metall und dem Windanlagenbauer Vestas um einen Tarifvertrag eskaliert abermals. Nach zwei Monaten am Verhandlungstisch hat die IG Metall die Gespräche abgebrochen und den Anfang März ausgesetzten Streik wieder aufgenommen.

«Wiederholt wurden vom dänischen Windanlagenhersteller Angebote und Zusagen wieder zurückgenommen», kritisierte die Gewerkschaft am 11. Mai. «Die Forderungen der IG Metall waren einfach nicht angemessen», sagte ein Firmensprecher auf Anfrage. «Wir haben ein großzügiges Angebot vorgelegt, das nicht angenommen wurde, und unsere folgenden Gegenvorschläge wurden von der IG Metall nicht anerkannt.»
Ende März hatten beide Seiten noch Zuversicht verbreitet. «Ziel der Tarifparteien ist es, zeitnah zu haustarifvertraglichen Regelungen zu kommen», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des IG Metall-Bezirks Küste und der Vestas Deutschland GmbH (Hamburg).
Dieser Optimismus ist verflogen. «Vertrauensvolle Tarifverhandlungen sehen anders aus. Angebote von einem Tag auf den anderen wieder vom Tisch zu nehmen, entspricht nicht unseren Erwartungen an einen verlässlichen Verhandlungspartner», sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, der Rendsburger IG-Metall-Geschäftsführer Martin Bitter.
Vestas hatte sich lange gegen Verhandlungen über einen Haustarif gesperrt, weil das Unternehmen ursprünglich nur mit dem Betriebsrat über Entgeltfragen sprechen wollte. Die IG Metall hatte daraufhin im vorigen Sommer einen Arbeitskampf gestartet. Zunächst gab es kürzere Warnstreiks, nach einer Urabstimmung seit November dann auch mehrtägige Streiks. Nach Darstellung von Vestas vertritt die größte deutsche Gewerkschaft nur eine Minderheit der Belegschaft. «Bei Vestas Deutschland streiken weniger als 15 Prozent der Kolleginnen und Kollegen.»
«Servicetechniker von Windanlagen haben sehr harte und herausfordernde Arbeitsbedingungen. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Regelungen für die Altersteilzeit gibt es bei Vestas bisher nicht», so die Gewerkschaft. «Anstatt mit der IG Metall konstruktiv zu verhandeln, verweigert sich Vestas und riskiert mit dem wieder aufgenommenen Streik sowohl bei Kunden als auch bei potenziellen Beschäftigten, weiter Ansehen zu verlieren.»
Bei Vestas Deutschland arbeiten nach Angaben der IG Metall rund 1700 Menschen, davon 700 als Monteure. Die Gewerkschaft beklagt seit langem, dass zwar viele Zulieferer wie Maschinenbauer dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie unterliegen. Bei Herstellern und im Servicebereich habe sich die Windbranche aber verbindlichen tariflichen Regeln bisher weitgehend verweigert.
(Text: dpa)
Deutlich weniger Arbeitskräfte bis zum Jahr 2060
Die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland wird voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten schrumpfen: Bis 2060 wird das Potenzial an Erwerbspersonen nach einer Projektion des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) um 11,7 Prozent zurückgehen. Dabei wurden Faktoren wie der demografische Wandel, Geburtenrate, Zuwanderung und Abwanderung berücksichtigt. «Die Ergebnisse zeigen, dass den Betrieben in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden», sagte IAB-Ökonom Enzo Weber.

Das IAB hatte schon vor längerer Zeit einen Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials um sieben Millionen Menschen vorhergesagt, wenn es keine Gegenmaßnahmen gebe. Die am Freitag veröffentlichte Projektion bezieht die Gegenmaßnahmen sowie zahlreiche äußere Faktoren wie die wirtschaftliche und demografische Entwicklung im Ausland, aber auch die Geburtenrate mit ein. Das Ergebnis danach ist fast noch ernüchternder: Das Potenzial sinkt immer noch um mehrere Millionen.
Positiv werden sich der Untersuchung zufolge in den nächsten Jahren etwa die Erwerbsquoten von Frauen und Älteren entwickeln. Bei deutschen Frauen unter 55 Jahren steigt die Quote von 87 auf 93 Prozent, bei Ausländerinnen von 67 auf 77 Prozent, die Geburtenrate steigt von 1,5 auf 1,7 Kinder pro Frau. «Wenn wir die Schrumpfung vermeiden wollen, müssen wir bei den Gegenmaßnahmen also noch mindestens zwei Schippen drauflegen», sagte Weber.
Ansatzpunkte sieht er in der Erwerbsbeteiligung, insbesondere ausländischer Frauen und Älterer, dem Abbau der Arbeitslosigkeit als auch weiterhin in der Migration. «Bei der Erwerbsmigration werden Drittländer gegenüber der EU immer wichtiger. Die Hürden müssen deshalb weiter abgebaut werden, gleichzeitig muss aber auch mehr dafür getan werden, dass Zugewanderte auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen und in Deutschland eine langfristige Perspektive finden», betonte Weber weiter.
Die Zuwanderung aus EU-Staaten wie Polen oder Rumänien wird der Studie zufolge bei bisherigen Anstrengungen deutlich abnehmen. Kamen im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre noch jeweils 900 000 Menschen aus EU-Staaten nach Deutschland, werden es im Jahr 2060 nur noch 600 000 sein. Im Gegenzug werde die Zuwanderung aus Drittstaaten von 240 000 auf 500 000 steigen. Gleichzeitig werde aber auch die Abwanderung von derzeit 750 000 Menschen auf eine Million steigen.
Der Projektion zufolge leben im Jahr 2060 nur noch 72,6 Millionen Menschen in Deutschland, rund zehn Millionen weniger als derzeit. Vor allem die Zuwanderung aus EU-Ländern dürfte stark zurückgehen, weil sich dort die Lebensbedingungen verbessern und die Demografie noch ungünstiger wirkt als in Deutschland.
(Text: dpa)